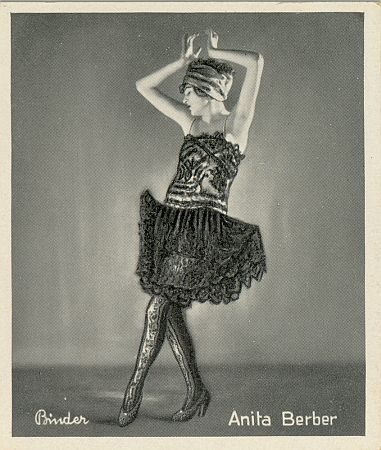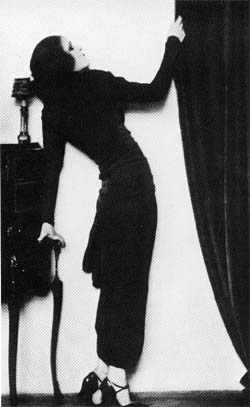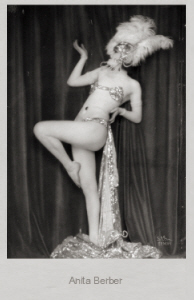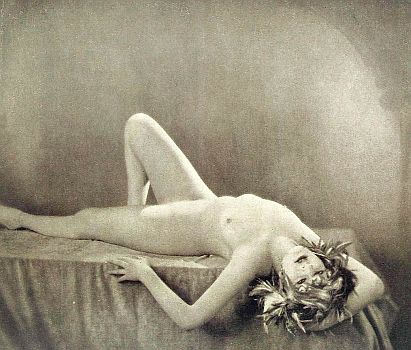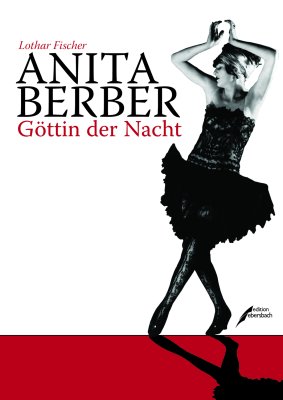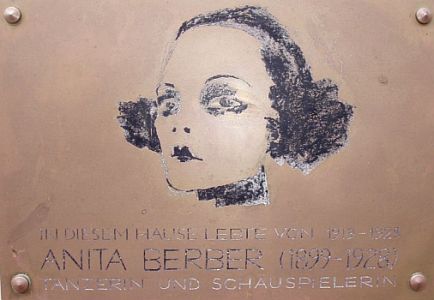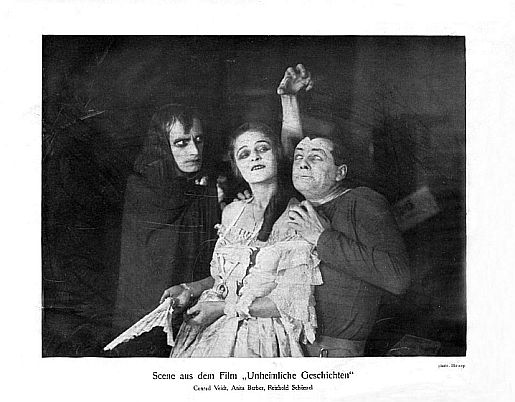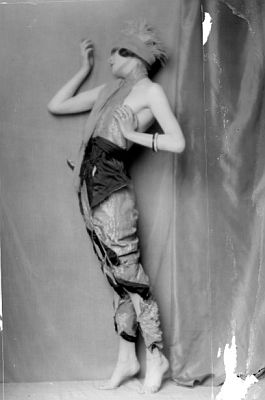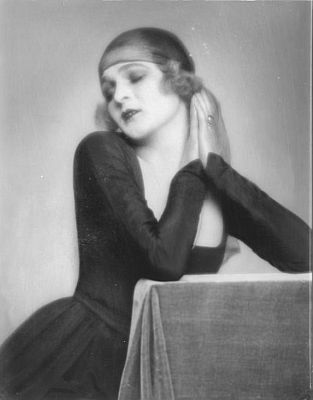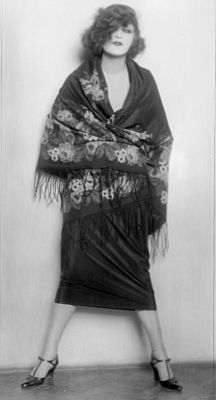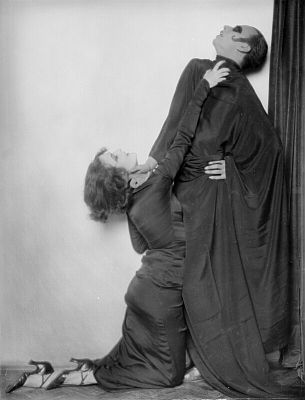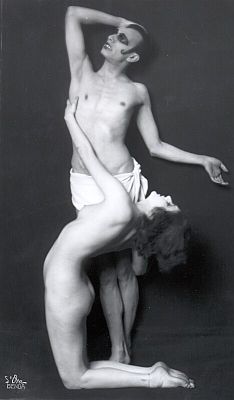|
Ihr Bühnendebüt gab die junge Anita dann am
24. Februar 1916 mit der Tanzschule im damals
beliebten "Blüthnersaal", einem großen, zum "Klindworth-Scharwenka-Konservatorium"1)
gehörenden Konzertsaal in der Genthiner Straße 11 (Berlin-Tiergarten1)).
Zwei Jahre später trennte sie sich von Rita Sacchetto, da
es zu Differenzen wegen Anita Berbers Tanzstil gekommen
war.
Nun begann eine überaus erfolgreiche Karriere als Solotänzerin, die
Berber erhielt ein erstes Engagement am Berliner "Apollo-Theater"1),
trat in Varietés wie dem "Wintergarten"1)
oder in den legendären Revuen von Rudolf
Nelson1) auf; Tourneen durch die
Schweiz, Ungarn und Österreich schlossen sich an. Nicht nur mit ihren
Bühnenauftritten als exaltierte Nackttänzerin sorgte sie bei der
gut-bürgerlichen Gesellschaft der
Weimarer Republik1)
für Skandale, auch durch ihr zügelloses Privatleben, ihre Alkohol-
und Drogensucht geriet sie in die Schlagzeilen der Presse, wurde
ebenso bewundert wie verachtet.
Anita Berber, in den 1920ern fotografiert
von Magnus Merck
(? – 1930)
Quelle: Wikimedia
Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
| "Dinah Nelken1),
mit der sie die Tanzschule besuchte, beschrieb sie folgendermaßen:
"Sie war ganz unschuldig und reizend. Sie war von Natur aus ein
heiterer Mensch"…" spontan und hemmungslos … Bei
aller Vorliebe für Flirts hatte sie einen unglaublichen Liebreiz,
ohne ordinär zu wirken." Das Modejournal "Elegante
Welt" suchte Berbers "eigenartigen Reiz" mit ihrer
"knabenhaften" Statur und "herben Schlankheit" zu
begründen. Doch nicht nur die Modewelt wurde auf sie aufmerksam, sie
prägte auch die Mode der Zeit. Sie war die erste Frau, die einen
Smoking trug: "Eine Zeit lang machten ihr in Berlin die mondänen
Weiber alles nach. Bis aufs Monokel. Sie gingen à la
Berber." berichtet Siegfried Geyer1)."
wird bei Wikipedia
ausgeführt.
|
|
1919 heiratete die Künstlerin den wohlhabenden Offizier und
Antiquar Eberhard von Nathusius (1895 – 1942),
Enkel des preußischen Politikers Philipp
von Nathusius1)
(1842 – 1900), eine Verbindung, die nur wenige
Jahre Bestand hatte; bereits am 10. Januar 1922 wurde
das Paar geschieden. Anita Berber machte aus ihrer
lesbischen Veranlagung keinen Hehl, zog zu ihrer Freundin, der
Barbesitzerin Susi Wanowsky. Mit ihrem kokainsüchtigen und
homosexuellen, als Willy Knobloch geborenen Tanzpartner Sebastian Droste1)
(1898 – 1927) ging sie für kurze Zeit eine
weitere Verbindung ein, 1923 heirate sie diesen in
Budapest. Kurz zuvor hatten beide in Wien mit dem ersten
gemeinsamen Programm "Tänze des Lasters, des Grauens und
der Ekstase", welches Nummern wie "Die Leiche am
Seziertisch", "Morphium", "Haus der
Irren" oder "Die Nacht der Borgia" enthielt, das
Publikum schockiert, aber auch angezogen, wie ein Magnet. Die
Wiener Gesetzeshüter schoben der öffentlichen
"Lasterhaftigkeit" ein Riegel vor, mehrgach wurden die
Berber und Droste von der Polizei aufgefordert, die Stadt zu
verlassen. 1923 veröffentlichte das Paar auch ein
bibliophiles Buch, in dem es Gedichte, Texte, Zeichnungen und
Fotografien zu ihren Choreographien präsentierte. Im
Foto-Atelier von Madame d'Ora1)
entstanden eine Reihe von ausdrucksstarken Aufnahmen, die damals
auch im "Berliner Magazin" und in der Mode-Zeitschrift
"Die Dame"1)
veröffentlicht wurden → einige Fotos siehe hier.
Foto: Anita Berber mit "Koreanischer Tanz"
© Kulturpressedienst Berlin 2001*)
|

|
| In den Wochen nach der Aufführung kam es immer
wieder zu Differenzen wegen nicht eingehaltener Verträge.
Droste wurde in Österreich wegen versuchten Betrugs verhaftet
und am 5. Januar 1923 ausgewiesen, Berbers Ausweisung nach
Ungarn erfolgte am 13. Januar 1923. In Budapest traf sich das
Paar erneut und ging zurück nach Berlin. Dort kam es zu einem weiteren Eklat: Droste hatte den
Schmuck seiner Frau entwendet, da er Geld für seine Drogensucht
brauchte, im Juni 1923 verschwand er bei Nacht und Nebel, setzte sich nach Amerika
bzw. nach New York ab; wenig später erfolgte die offizielle Scheidung. Sebastian Droste,
der in New York als Amerika-Korrespondent für die "B.Z. am
Mittag"1) arbeitete, starb
nach seiner Rückkehr aus den USA am 27. Juni 1927 in
Hamburg1).
|
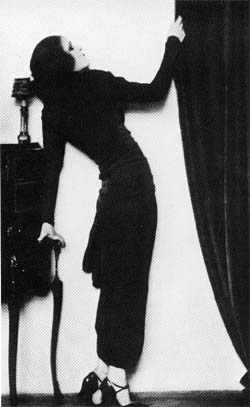 |
Berbers neuer Tanzpartner wurde der ebenfalls homosexuelle
US-Amerikaner Henri Chátin-Hofmann1)
(1900 – 1961), den sie am
10. September 1924 heiratete. Mit ihm zusammen trat
sie unter anderem erfolgreich in Berliner
Kabaretts/Kleinkunstbühnen wie "Die
Rakete"1), der von Rosa Valetti
gegründeten "Die Rampe", "Weiße Maus" oder
"Schall und Rauch"1)
auf, gab aufsehenerregende Gastspiele beispielsweise in Köln,
Düsseldorf, Leipzig und Breslau. Mit dem Nachfolgeprogramm der
"Tänze des Lasters…", den "Tänzen der Erotik
und Ekstase", wurde das Publikum erstmals im Hamburger
"Alkazar"1)
(ab 1936 "Allotria") konfrontiert, eine Tournee
durch den
Nahen Osten1)
schloss sich an. Während eines Auftritts in Damaskus1)
brach Anita Berber am 13. Juni 1928 auf der Bühne
zusammen; eine Untersuchung ergab, dass sie an Tuberkulose1)
ohne Chance auf Heilung erkrankt war. Das Paar begab sich
zurück nach Europa, kam jedoch wegen Geldschwierigkeiten nur
bis Prag. Mit Hilfe von Spenden aus Berliner Künstlerkreisen
konnte Berber von Freunden nach Berlin transportiert, wo sie am
10. November 1928 im "Bethanien-Krankenhaus"1)
in
Berlin-Kreuzberg1),
von ihrer Krankheit und Drogensucht gezeichnet, mit nur
29 Jahren starb. Die letzte Ruhe fand Anita Berber auf dem Neuköllner1)
"Neuen Friedhof der St.-Thomas-Gemeinde", das Grab
existiert nach der Stilllegung des Friedhofs nicht mehr (heute:
"Anita-Berber-Park"1),
westlich der Hermannstraße1)).
Foto:
© Kulturpressedienst Berlin 2001*)
bzw.
© Österreichische Nationalbibliothek
(ÖNB), Bildarchiv
(Inventarnummer 204418-D)
Urheber: Atelier Madame d'Ora1)
(1881–1963)
Datierung: 28.10.1922
|
|
Nicht nur als Bühnenkünstlerin machte die "Tänzerin des
Lasters" Furore, auch auf der noch stummen Leinwand konnte das
breite Publikum die skandalträchtige Diva bewundern. Erstmals wirkte
sie unter der Regie von Richard Oswald1)
als Tänzerin Grisi in "Das Dreimäderlhaus"1) (1918)
mit, einer freien Adaption des gleichnamigen
Bühnenstücks1) von Heinrich Berté1)
(Musik) und Alfred Maria Willner1)
und Heinz Reichert1)
(Libretti) nach dem Roman "Schwammerl"1)
von Rudolf Hans Bartsch1)
mit dem Tenor und Schauspieler Julius Spielmann2)
(1866 – 1920) als Komponist Franz Schubert1)
sowie mit Sybille Binder1)
(Hannerl),
Käthe Oswald1)
(Heiderl) und Helga Molander
(Hederl). Im selben Jahr betraute Oswald sie mit der Titelrolle in dem
Melodram "Dida Ibsens Geschichte"1)
mit dem Untertitel "Ein Finale zum "Tagebuch
einer Verlorenen"1) von Margarete Böhme"1)",
wo sie auch erstmals als Partnerin des Stummfilm-Stars Conrad Veidt
in Erscheinung trat. Bis 1922 zeigte sie sich mit prägnanten
Rollen neben Veidt in weiteren, von Oswald Produktionen, so in "Das
gelbe Haus"3) (1919), dem
ersten Teil des zweiteiligen Sittenfilms "Die Prostitution"1)
und in dem das Thema Homosexualität behandelnden Streifen "Anders als die Andern"1) (1919),
der nach Wiedereinführung der Zensur verboten wurde. In "Die
Reise um die Erde in 80 Tagen"1) (1919)
nach dem Roman "In
80 Tagen um die Welt"1)
von Jules Verne1)
mit Veidt als Phileas Fogg mimte Berber die junge parsische1)
Witwe Aouda, in "Unheimliche
Geschichten" (1919), einem Episodenfilm nach den
Erzählungen "Die Erscheinung" von Anselma Heine1),
"Die Hand" von Robert Liebmann1),
"Die
schwarze Katze"1) von Edgar Allan Poe1),
"Der
Selbstmörderklub"1)
von Robert Louis Stevenson1)
und "Der Spuk" von Richard Oswald übernahm sie neben
Veidt und Reinhold Schünzel
diverse Rollen. |
|
1920 folgte mit "Nachtgestalten"1)
die Verfilmung des Romans "Eleagabal Kuperus" von Karl Hans Strobl1),
die letzte Zusammenarbeit mit Oswald war das nach einem Roman von
Harry Scheff (1861 – 1926) entstandene Historiendrama "Lucrezia Borgia"1) (1922)
mit Liane Haid
als Lucrezia Borgia1)
und Veidt als Cesare Borgia1),
wo sie als Gräfin Julia Orsini1)
(geb. Giulia Farnese) eine der Mätressen1)
von Rodrigo Borgia, dem späteren Papst Alexander VI.1)
(Albert Bassermann)
darstellte. Unter anderem gab ihr Reinhold Schünzel, der selbst
den Titelhelden Alessandro Cagliostro1)
darstellte, in dem Biopic "Der Graf von Cagliostro"1) (1921)
die weibliche Hauptrolle von Cagliostros schönen, aber skrupellosen
Frau Lorenza, in Fritz Langs1)
berühmten Zweiteiler "Dr. Mabuse, der Spieler"1) (1922)
mit Rudolf Klein-Rogge
als Arzt und Psychoanalytiker bzw. Superverbrecher
Dr. Mabuse1)
präsentierte sie sich als "Tänzerin im Frack". Letztmalig
sah man sie in dem von Max Neufeld1)
in Szene gesetzten Melodram "Ein Walzer von Strauß"1) (1925)
auf der Leinwand. Bis dahin hatte Anita Berber für rund 25 Filme, meist als Tänzerin, Prostituierte oder
"gefallenes Mädchen" vor der Kamera gestanden, unter
anderem, neben ihrem bevorzugten Partner Conrad Veidt, auch an
der Seite von Stars wie
Hans Albers
und Emil Jannings
→ Übersicht Stummfilme.
Anita Berber am Kamin ihres Hauses in Berlin,
veröffentlicht in "Die Dame"1) (5/1918)
Urheber: Waldemar Titzenthaler1)
(1869 – 1937)
Quelle: Enno Kaufhold: "Berliner Interieurs, Photographien von
Waldemar Titzenthaler" (Berlin: Nicolai, 1999, S. 21)
bzw. Wikimedia
Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|

|
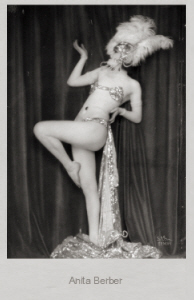 |
Anita Berber, die "schillernde Nachtgestalt" der wilden
1920er Jahre, faszinierte mit ihren unkonventionellen,
expressionistischen Ausdruckstänzen nicht nur das "normale"
Publikum, auch in der Künstlerszene jener Zeit hatte sie viele
Anhänger: So etwa den Maler Otto Dix1)
(1891 – 1969), der sie 1925 mit seinem Gemälde
"Portrait einer Dame in
Rot"1), welches heute nach
vielen Umwegen im "Kunstmuseum
Stuttgart"1) zu sehen ist,
unsterblich werden ließ. Es zeigt die Schauspielerin vor einem roten
Hintergrund in einem roten, eng anliegenden und hochgeschlossenen
Seidenkleid mit langen Ärmeln → sammlung.kunstmuseum-stuttgart.de;
die "Deutsche Bundespost"1)
brachte am 5. November 1991 anlässlich des
100. Geburtstages von Otto Dix eine Sondermarke mit diesem
Portrait heraus → i.colnect.net.
Auch der Schriftsteller Klaus Mann1)
(1906 – 1949), der Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann1),
war von ihr beeindruckt. Das Porzellan-Unternehmen "Rosenthal"1)
stellte Miniaturen ("Koreanischer Tanz" und
"Pierrette") nach ihrem Abbild her, geschaffen nach Modellen
des Wiener Bildhauers Constantin Holzer-Defanti1).
Der dänische Maler Hugo Vildfred Pedersen (1870 – 1959)
schuf ein Nackt-Bild mit Berber am Schminktisch → Abbildung
bei Wikimedia Commons.
Anita Berber 1922
Fotos mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek1)
(ÖNB)
Urheber: Atelier Madame d'Ora1)
(1881–1963); © ÖNB/Wien, Bildarchiv
Anita Berber Datierung: 09.12.1922: (Inventarnummer
204422-D)
|
|
Der "Modepapst" Karl Lagerfeld1)
(1933 – 2019) bezeichnete sie einmal als "die
gewagteste Frau ihrer Zeit", für die Schauspielerin und
Filmemacherin Leni Riefenstahl
(1902 – 2003) war ihr Körper so vollkommen, "dass
ihre Nacktheit nie obszön wirkte". Rosa von Praunheim1)
drehte 1987 den Film "Anita – Tänze des
Lasters"1) (→ siehe
auch filmzentrale.com
und filmportal.de)
unter anderem mit Lotti Huber,
welche eine alte Frau darstellt, die sich als Insassin eines
Pflegeheims für Anita Berber hält und Geschichten aus deren
Leben erzählt. Im "Lexikon des internationalen Films" kann
man hierzu nachlesen: "Der Film zeichnet liebevoll-ironisch,
bisweilen aber auch mit bizarren Mitteln die Triviale Formen- und
Gefühlswelt der Stummfilmzeit als utopisches Gegenbild zu einer trist
normierten Gegenwart. Eine größtenteils eigenwillige und
fantasievolle Handlung an die exaltierte Ästhetik der zwanziger Jahre
und an die Unzerstörbarkeit menschlicher Lebensart und
Einbildungskraft." → filmdienst.de
Anita Berber, um 1921 fotografiert von Alexander
Binder (1888 – 1929)
Quelle: Wikimedia
Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
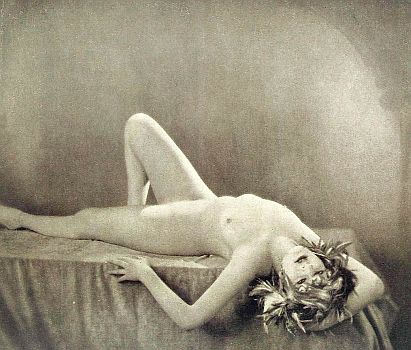 |
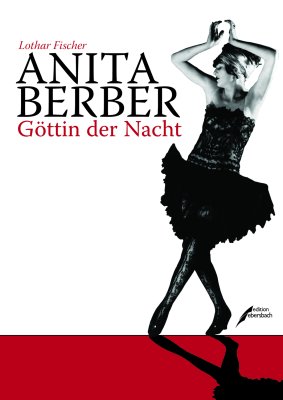 |
Lucinda Jarrett brachte 1999 "Striptease. Die Geschichte der
erotischen Entkleidung"
("Rütten & Loening-Verlag", Berlin) auf den Markt. Von
dem Berliner Kunsthistoriker
Lothar Fischer1)
erschien Mitte der 1980er Jahre das Buch "Tanz zwischen Rausch und
Tod. Anita Berber 1918 bis 1928 in Berlin"
("Haude & Spener-Verlag", Berlin 1984), welches
nur noch antiquarisch zu erhalten ist. Im Oktober 2006 veröffentlichte
Lothar Fischer im Verlag "edition ebersbach" seine zweite komplexere
Biografie, den Text-Bildband "Anita Berber – Göttin der
Nacht" und zeichnet hierin nach jahrelanger Recherche das kurze Leben der
Exzentrikerin anhand von zeitgenössischen Dokumenten, unveröffentlichten
Fotos und Aussagen von Zeitzeugen nach → siehe auch den
SPIEGEL-Artikel bei spiegel.de
sowie weitere Literatur bei Wikipedia.
Abbildung des Buchcovers mit freundlicher Genehmigung
des Verlages edition
ebersbach |
|
|
|
- 1918–1922: Filme unter der Regie von Richard
Oswald
- 1918: Das Dreimäderlhaus. Schuberts Liebesromanze
(frei nach dem gleichnamigen
Bühnenstück von Heinrich
Berté (Musik)
und Alfred
Maria Willner, Heinz
Reichert (Libretti) nach dem Roman "Schwammerl"
von Rudolf
Hans Bartsch;
mit dem Tenor und Schauspieler Julius
Spielmann (1866–1920) als Franz
Schubert;
mit Sybille Binder (Hannerl),
Käthe Oswald (Heiderl) und Helga
Molander (Hederl); als Tänzerin Grisi)
- 1918: Dida Ibsens Geschichte.
Ein Finale zum "Tagebuch einer Verlorenen" von
Margarete Böhme
(als Dida Ibsen;
Conrad
Veidt als Erik Norrensen) → filmportal.de
- 1919: Die
Prostitution, 1. Teil – Das gelbe Haus
(als Lola, eine der Töchter des
Agenten Klaßen (Fritz
Beckmann);
Conrad Veidt als Alfred Werner, der Lolas Schwester Hedwig (Gussy
Holl) heiratet)
- 1919: Die Reise um die Erde in 80 Tagen
(nach dem Roman "In
80 Tagen um die Welt" von Jules
Verne; mit Conrad Veidt
als Phileas Fogg; als die junge parsische
Witwe Aouda) → filmportal.de
(Foto)
- 1919: Anders als die Andern
(mit Conrad Veidt als homosexueller Violinvirtuose Paul Körner;
als Else, Schwester von
Paul Körners Schüler Kurt Sievers (Fritz
Schulz)) → filmportal.de
- 1919: Unheimliche
Geschichten (Episodenfilm nach den Erzählungen "Die
Erscheinung" von Anselma
Heine,
"Die Hand" von Robert
Liebmann, "Die
schwarze Katze" von Edgar
Allan Poe, "Der
Selbstmörderklub" von
Robert
Louis Stevenson und "Der Spuk" von Richard Oswald;
mit Conrad Veidt und Reinhold Schünzel) → filmportal.de
als die
- Dirne in der Rahmenhandlung
- Frau in Episode 1 "Die Erscheinung"
- Freundin in Episode 2 "Die Hand"
- Frau des Betrunkenen (Reinhold Schünzel) in
Episode 3 "Die schwarze Katze"
- Schwester des Clubpräsidenten (Conrad Veidt) in Episode 4 "Der Selbstmörderclub"
- Ehefrau in Episode 5 "Der Spuk" (Conrad Veidt
als Ehemann)
- 1920: Nachtgestalten
(nach dem Roman "Eleagabal Kuperus" von Karl
Hans Strobl; als Tänzerin, Conrad Veidt als Clown)
→ filmportal.de
- 1922: Lucrezia Borgia
(nach einem Roman von Harry Scheff (1861–1926); mit Liane Haid
als Lucrezia Borgia,
Conrad
Veidt als Cesare Borgia; als Gräfin Julia
Orsini (geb. Giulia Farnese), eine der Mätressen
von Rodrigo Borgia,
dem
späteren
Papst Alexander VI. (Albert
Bassermann)) → filmportal.de
- 1919: Peer Gynt
(nach dem gleichnamigen dramatischen
Gedicht von Henrik
Ibsen; R: Victor
Barnowsky;
mit Heinz
Salfner als Peer Gynt; Conradt
Veidt als ein fremder Passagier/Knopfgießer; als ?)
- 1920: Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner
(von (Regie/Drehbuch) und mit Arthur
Bergen; als ?)
- 1920: Der Schädel der Pharaonentochter
(R: Otz
Tollen; mit Emil
Jannings als Pharao Osorco, Erna
Morena als Prinzessin
Amnertis; als ?)
- 1920: Falschspieler.
Die Tragödie eines Entgleisten (R: Emil
Justitz; mit Emil
Mamelok als der Falschspieler;
Hans Albers als Harald Petersen;
als Tänzerin Asta)
- 1920: Der Graf von Cagliostro
(von (Regie) und mit Reinhold Schünzel
als Alessandro
Cagliostro / Graf Phönix;
als dessen Frau Lorenza; Conrad
Veidt als Minister)
- 1921: Lucifer
(R: Ernest Jahn; als ?)
- 1921: Verfehltes Leben
(R/Drehbuch/Kamera: Maurice
Armand Mondet; als ?)
- 1921: Die Nacht der Mary Murton (R: Friedrich
Porges; als ?)
- 1921: Die goldene Pest (nach dem Roman von Øvre Richter
Frich (1872–1945);
von (Regie; Co-Regie: Richard Oswald)
und mit Louis Ralph
als Jacques Delma; als Natascha; Kurzinfo: Ein Anarchist versucht, eine Formel für künstliches
Gold
als Teil eines Plans
zu verwenden, um den Weltmarkt zu überschwemmen, was eine internationale Krise verursacht.)
→ IMDb
- 1922: Schminke.
Sigrids Werdegang (R: Fritz
Kaufmann; als ?)
- 1922: Die vom Zirkus
(R: William
Kahn; als Tatja, die Zirkusdiva)
- 1921/22: Dr.
Mabuse, der Spieler (nach der Romanvorlage von Norbert
Jacques über den (fiktiven) Superverbrecher Dr.
Mabuse;
R: Fritz
Lang; mit Rudolf
Klein-Rogge als der Arzt und Psychoanalytiker Dr. Mabuse; als
Tänzerin)
- 1922: Im Kampf mit dem unsichtbaren Feind (R: Erich
Schönfelder; als Bessie, Freundin von Fred) → IMDb
- 1923: Wien, du Stadt der Lieder (R: Alfred
Deutsch-German; als ?) → IMDb
- 1923: Irrlichter der Tiefe (R: Fritz
Freisler; als Göttin Astarte)
→ IMDb
- 1923: Die Drei Marien und der Herr von Marana
(von (Regie/Drehbuch mit Robert
Liebmann/Produktion) und mit
Reinhold
Schünzel als als Don Juan de la Marana; als ?) → IMDb
- 1923: Moderne Tänze
/ Tänze des Grauens, des Lasters und der Ekstase (Kurz-Dokumentarfilm)
- 1924: Die Zirkusdiva (R: William
Kahn; als Tänzerin Manja)
 |
Lichtbild/Standfoto aus
"Die vom Zirkus" (1922)
Anita Berber als Tatja, die Zirkusdiva
© Kulturpressedienst Berlin 2001*)
|
- 1925: Ein Walzer von Strauß
(R: Max
Neufeld; als Tänzerin)
|
|