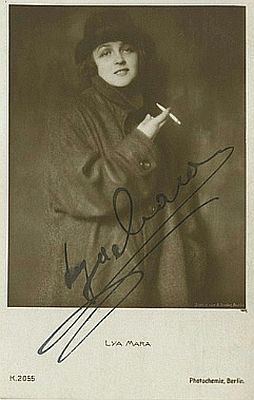Filmografie / Fotos
|
 |
| Lya Mara wurde am 1. August 1893*)
als Aleksandra Gudoviča und
Tochter des Gerichtsbeamten Anton Gudowicz im damals zum Russisches
Kaiserreich1) gehörenden Riga1)
(heute: Lettland1)) geboren. Schon früh zeigte sich ihre
Begabung für Naturwissenschaften, sodass ihre Eltern ihr den Besuch
eines Gymnasiums ermöglichten. Als der Vater starb, konnte Mutter
Mathilde,
die neben Lya noch fünf weitere Geschwister ernähren musste, die
Kosten für das Gymnasium nicht mehr aufbringen und Lya musste die
Schule verlassen. Da sie sich auch schon immer für Schauspielerei und
Tanz interessiert hatte, entschloss sich das junge Mädchen, in Riga
eine Ballettschule zu besuchen und erhielt wenig später ein erstes
Engagement am dortigen Stadttheater. |
Rasch avancierte Lya Mara zu einer
gefragten Solotänzerin, bereits zu Beginn des 1. Weltkrieges stieg sie
in Warschau1) zur Primaballerina auf. Hier wurde der Produzent, Regisseur
und Schauspieler Friedrich Zelnik
(1885 – 1950) auf sie aufmerksam,
der sie 1917 zum Film nach Berlin holte und das attraktive junge Mädchen
später ehelichte. Bereits
in Polen hatte die Tänzerin unter der Regie von Aleksander Hertz1) für einige, wenn auch unbedeutend
gebliebene Stummfilme vor der Kamera gestanden, darunter "Studenci" (1916, "Studenten")
und "Bestia"1) (1917)
mit Pola Negri.
In den nachfolgenden Jahren arbeitete Lya Mara nun fast ausschließlich für den
Film.
Anfangs zeigte sie sich in einigen von Alfred Halm1) in Szene gesetzten
Produktionen an der Seite von Zelnik, so unter anderem im ersten
Teil der Adaption "Das
Geschlecht der Schelme"1) (1917) nach dem
Roman von Fedor von Zobeltitz1) (1918 auch in
Teil 2) und "Die Rose von Dschiandur" (1918) oder unter
der Regie von Lupu Pick in
"Die
Rothenburger" (1918) nach dem gleichnamigen Roman von Adolf von Wilbrandt1).
Als Zelnik, den sie am 1. Juli 1920 heiratete, dann selbst als
Regisseur zahlreiche Stummfilme inszenierte bzw. produzierte, wurde sie dessen
bevorzugte Protagonistin in den Unterhaltungsstreifen jener Ära. Nur
wenige Male arbeitete Lya Mara noch mit anderen Regisseuren
zusammen.
Lya Mara vor 1929
Urheber: Alexander
Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com; Ross-Karte Nr. 4180/1
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
|
|
|
Nach dem Roman "La petite Fadette" von George Sand1) realisierte
Zelnik den prominent besetzten Streifen "Die
lachende Grille"1) (1926), in
dem Liedtke als der schmucke Bürgermeistersohn Landry auftauchte, der
das Herz der kleinen Fadette (Lya Mara) erobert, die von allen nur die
"Grille" genannt wird. Einmal mehr neben Dieterle (Sandor Barinkay)
sowie Michael Bohnen (der reiche Schweinezüchter Kálmán Zsupán)
spielte sie
in "Der Zigeunerbaron" (1927) nach der gleichnamigen
Operette1) von Johann Strauss1) (Sohn),
mit Fred Louis Lerch als Partner zeigte sie sich
in dem Lustspiel "Heut’
tanzt Mariett"1) (1928) und
in dem Melodram "Mary Lou"1) (1928).
Ihr vorletzter, von Zelnik gedrehter Stummfilm hieß "Mein
Herz ist eine Jazzband"1) (1929), anschließend folgte
noch mit "Der
rote Kreis"1) (1929) die
Verfilmung des Romans "The Crimson Circle" von Edgar Wallace1), wo sie als
die betrügerische Thalia Drummond, Sekretärin
von Mr. Froyant (Albert Steinrück), in
Erscheinung trat,
in die sich der Sohn des ermordeten Birdmore Jack (Fred Louis Lerch)
verliebt → Übersicht Stummfilme.
Lya Mara 1922
Urheber: Atelier Madame d'Ora (1881–1963)
Fotos mit freundlicher Genehmigung der
Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204398-D)
|
 |
 |
Anschließend zog sich Lya Mara weitestgehend vom Filmgeschäft zurück,
wohl auch wegen eines
schweren Autounfalls, den sie Ende der 1920er Jahre erlitten hatte.
Lediglich 1931 zeigte sie sich noch einmal in dem Tonfilm bzw. der
Komödie "Jeder fragt nach Erika"3) – natürlich
unter der Regie ihres Ehemannes – als die
Parfümerie-Verkäuferin Erika Poliakoff, die nach einigen Turbulenzen
und Verwicklungen mit dem Baron Kurt von Zeillern (Walter Janssen) glücklich wird.
Mit dieser Produktion endete die Filmkarriere von Lya Mara.
Die Schauspielerin und Tänzerin, die vor allem für ihre Darstellung des typischen Wiener Mädels berühmt geworden
ist, war dem Stummfilm mit seinen Kolportagen verhaftet, die Zelnik
ganz auf seine Frau zugeschnitten hatte. Zur Kinokönigin stieg sie
auf, als sie Unschuld mit Sex-Appeal, Naivität mit Koketterie mischte;
sie konnte einfache Mädchen ebenso verkörpern wie mondäne,
standhafte Damen.**)
Seit ihrer Heirat mit Zelnik gehörte Lya Mara zur Berliner Film- und
Künstlerszene, in ihrem Haus gingen bekannte Filmschaffende der
damaligen Zeit ein und aus. Ihr Publikumserfolg schlug sich auch in
einer Romanheftchen-Reihe nieder, welche zwischen 1927 und 1928
erschien.
Lya Mara 1922
Urheber: Atelier Madame d'Ora (1881–1963)
Fotos mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204397-D) |
Nach der so genannten Machtergreifung1)
der Nationalsozialisten Ende Januar 1933 emigrierte das Paar nach
Großbritannien bzw. London, wo Zelnik nun unter dem Vornamen
"Frederic" als Regisseur sowie als Produzent tätig war;
Lya Mara stand dort jedoch nicht mehr vor der Kamera. Nach dem Tod
ihres Mannes im Jahre 1950 zog sie sich vollständig aus der
Film-Szene zurück und soll in die westliche Schweiz gegangen sein, wo
sie am 1. November 1969 in
Lausanne1)
in der "Clinique Bois-Cerf"1)
starb; die letzte Ruhe fand sie auf dem dortigen "Friedhof
Bois-de-Vaux"1).
Wie zum Geburtsjahr gibt es auch zum Todesdatum unterschiedliche
Angaben, so weist Kay Weniger1)
in seinem Lexikon "Es wird im Leben dir mehr genommen als
gegeben …"4)
ebenso wie die "Internet Movie Database"
den 1. März 1960 aus.
|

|
Textbausteine des Kurzportraits aus
"Lexikon der deutschen Film- und
TV-Stars"**)
sowie von cyranos.ch;
siehe auch Wikipedia
Fotos bei virtual-history.com,
filmstarpostcards.blogspot.com
|
*) Laut Wikipedia und filmportal.de;
IMDb,
das "Lexikon der deutschen Film- und TV-Stars"
und Kay
Weniger ("Es wird im Leben dir mehr
genommen als gegeben …") weisen 1897 aus,
**) "Lexikon der deutschen Film- und TV-Stars" von
Adolf
Heinzlmeier/Berndt Schulz
(Ausgabe 2000, S. 235)
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) filmportal.de, 3) Murnau Stiftung
4) Kay
Weniger: "Es wird im Leben dir mehr
genommen als gegeben …". Lexikon der aus Deutschland und Österreich
emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945. Eine Gesamtübersicht".
(Acabus-Verlag, Hamburg 2011, S. 330/331)
Lizenz Foto Lya Mara (Urheber Alexander Binder):
Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre
urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die
Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle
weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren
nach dem Tod des Urhebers.
Lizenz Foto Ly Mara (Urheber: Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) / Heinrich Maass (1860–1930)):
Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist
abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren
Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach
dem Tod des Urhebers.
|

|
|
|

|
|
|
Stummfilme
- 1916/17: Produktionen in Polen unter der Regie von Aleksander Hertz
- 1916: Wsciekly rywal (als ?) → IMDb
- 1916: Studenci
/ Studenten (mit Pola
Negri; als Stasia Majewska)
- 1916: Chcemy meza (als ?) → IMDb
- 1917: Bestia
(mit Pola
Negri; als ?)
- Produktionen in Deutschlandj
- 1917: Ballzauber
(R: Danny
Kaden; als ?)
- 1917/18: Das Geschlecht der Schelme (nach dem Roman von Fedor von Zobeltitz;
R: Alfred
Halsm; mit Friedrich
Zelnik
in der Doppelrolle des Grafen Eberhard von Gheyn / Freddy
Petzold; als Gräfin Mary Gheyn, geborene Runkel)
- 1918: Halkas
Gelöbnis (R: Alfred Halm alias H. Fredall; als Halka,
Pflegeschwester des Grafen
Symon Barinowsky (Hans
Albers (Zuordnung unsicher)) → filmportal.de (Foto)
- 1918: Die Rose von Dschiandur
(R: Alfred Halm; als Saidjah, Friedrich Zelnik als Sultan von Dschiandur)
→ Early Cinema Database
- 1918: Die Serenyi (nach
der Erzählung von Otto Erich Hartleben;
R: Alfred Halm; als Diva) → Early Cinema Database
- 1918: Die Nonne und der Harlekin
(nach dem Roman von Franz
Wolfgang Koebner (auch Drehbuch;
R: Alfred Halm; als ?) → Early Cinema Database
- 1918: Die Rothenburger / Leib und Seele
(nach dem Roman "Die Rothenburger" von Adolf von Wilbrandt;
R: Lupu
Pick (auch Darsteller); als Lene sowie deren Tochter;
Friedrich Zelnik als Dr. Richard Neidlinger
alias Dr. Tauber) → filmportal.de (Foto)
- 1918–1929: Filme unter der Regie von Friedrich Zelnik
- 1918/19: Margarete. Die Geschichte einer Gefallenen
(nach der Vorlage von Marie von
Ebner-Eschenbach;
als Margarete) → Early Cinema Database
- 1919: Charlotte Corday
(als Charlotte Corday)
→ Early Cinema Database
- 1919: Die Damen mit den Smaragden (als ?) → IMDb
- 1919: Die Erbin
des Grafen von Monte Christo
(nach dem Roman von Matthias Blank (1881–1928);
als Helene Montfort) → Early Cinema Database
- 1919: Das Fest der Rosella
(als Rosella) → Early Cinema Database
- 1919: Das Haus der Unschuld (als ?) → Early Cinema Database,
IMDb
- 1919: Manon.
Das hohe Lied der Liebe (nach dem Roman "Manon Lescaut" von
Antoine-François Prévost;
als Manon Lescaut,
Fred Goebel als Chevalier des Grieux)
- 1919: Maria Evere
(nach dem Werk von Franz Wolfgang Koebner
(auch Drehbuch); als Schauspielerin Maria Evere)
- 1920: Kri-Kri, die Herzogin von Tarabac
(als Tänzerin / Herzogin Kri-Kri)
- 1920: Die Erlebnisse der berühmten Tänzerin Fanny Elßler (als
Fanny Elßler) → IMDb
- 1920: Anna Karenina
(nach dem gleichnamigen
Roman von Leo
Tolstoi; als Anna Karenina, Gattin von
Staatsrat Karenin (Heinrich
Peer))
- 1921: Fasching
(als die junge Frau; Heinrich Peer als deren Vater)
- 1921: Die Geliebte des Grafen Varenne
(als die Geliebte) → IMDb
- 1921: Miss Beryll …Die Laune eines Millionärs (als
Miss Beryll, Erich Kaiser-Titz als der Millionär)
→ IMDb
- 1921: Aus den Memoiren einer Filmschauspielerin
(als die Filmschauspielerin)
- 1921: Trix, der Roman einer Millionärin
(als Trix)
- 1921: Tanja, die Frau an der Kette (als
Tanja Fedorovna)
→ IMDb
- 1921: Das Mädel vom
Piccadilly (2 Teile; als das Mädel)
- 1921: Die Ehe der Fürstin Demidoff
(als Fürstin Demidoff, Gattin von Fürst Demidoff (Hermann
Vallentin))
- 1922: Die Geliebte des Königs
(als die Geliebte?)
- 1922: Yvette, die Modeprinzessin
(als Yvette)
- 1922: Die Tochter Napoleons
(als Marion; Ludwig
Hartau als Napoleon
Bonaparte)
- 1922: Erniedrigte und Beleidigte
(nach dem gleichnamigen
Roman von Fjodor
Dostojewski; als ?)
- 1923: Das Mädel aus der Hölle
(als ?)
- 1923: Die Männer der Sybill
(als Sybill)
- 1923: Lyda Ssanin
(nach dem Roman "Sanin" von Michail
Arzybaschew; als Lyda Ssanin) → filmportal.de
- 1923: Katjuscha Maslowa
/ Auferstehung (nach dem Roman "Auferstehung"
von Leo
Tolstoi;
als Katjuscha Maslowa; Rudolf
Forster als Fürst Dimitri Nechludow)
- 1923: Daisy. Das Abenteuer einer Lady
(als Daisy)
- 1924: Nelly, die Braut ohne Mann
(als Nelly)
- 1924: Die Herrin von Monbijou
(als die Titelheldin)
- 1924: Das Mädel von Capri
(als Bianca, das Waisenmädchen)
- 1924: Auf Befehl der Pompadour
(als Lucienne / Marquise
de Pompadour) → filmportal.de (Foto)
- 1925: Die Venus von Montmartre
(als Joujou, die Venus vom Montmartre)
- 1925: Die Kirschenzeit (Kurz-Spielfilm; als ?) → IMDb
- 1925: Frauen, die man oft nicht grüßt
(als Nina)
- 1926: Die Försterchristel (nach
der gleichnamigen
Operette von Georg
Jarno (Musik); als Försterchristl;
Harry
Liedtke als österreichischer Kaiser Joseph
II.; Wilhelm
Dieterle
als Korporal Földessy) → filmportal.de (Foto)
- 1926: An der schönen blauen Donau (als
Mizzi Staudinger) → filmportal.de (Foto)
- 1926: Die lachende Grille
(nach dem Roman "La petite Fadette" von George
Sand; als Fadette, die "lachende Grille";
Harry
Liedtke als schmucke Bürgermeistersohn Landry; u. a. Dagny
Servaes als George Samd, Rudolf
Klein-Rogge als
Komponist Gioachino
Rossini)
- 1927: Der Zigeunerbaron
(nach der gleichnamigen
Operette von Johann
Strauss (Sohn); als Saffi; mit
Michael
Bohnen als Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter, Wilhelm
Dieterle als Sandor Barinkay)
- 1927: Die Weber
(nach dem gleichnamigen
Drama von Gerhart
Hauptmann; mit Wilhelm Dieterle als der Reservist
Moritz Jäger; u. a. Paul
Wegener als Fabrikant Dreißiger; als ?) → Murnau
Stiftung, filmportal.de,
prisma.de
- 1927: Das tanzende
Wien. An der schönen blauen Donau. 2. Teil (als
Komtesse Frizzi Zirsky)
- 1928: Heut' tanzt Mariett
(als Mariett) → filmportal.de
- 1928: Mary Lou
(als Mary Lou)
- 1929: Mein Herz ist eine Jazzband
(als Jessie)
- 1929: Der rote Kreis
(nach dem Roman "The Crimson Circle" von Edgar
Wallace; als die Betrügerin
Thalia Drummond, Sekretärin von Mr. Froyant (Albert
Steinrück)) → filmportal.de
- 1919: Die kleine Staszewska (R: Alfred
Halm; als Grafentochter) → Early Cinema Database,
IMDb
- 1920: Eine Demimonde-Heirat
/ Demimonde-Ehe (nach dem Schauspiel von Émile
Augier; R: Martin
Zickel;
als Lebedame Iza, Tochter von Anuschka (Ilka
Grüning)) → Early Cinema Database
- 1920: Die Prinzessin vom Nil (R: Martin Zickel; als
"die Mumie" Naomi) → Early Cinema Database,
IMDb
- 1920: Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner (R:
Arthur
Bergen; als Geisha) → IMDb
- 1920: Der Apachenlord (R: Fred
Sauer; als ?; u. a. mit Friedrich
Zelnik) → IMDb
- 1921: Wer unter Euch ohne Sünde ist…
(R: Fred Sauer; als ?)
- 1924: Ein Weihnachtsfilm für Große
(Kurz-Spielfilm von (Regie) und mit Paul Heidemann;
als ?)
Tonfilm
|
|

|