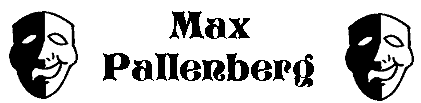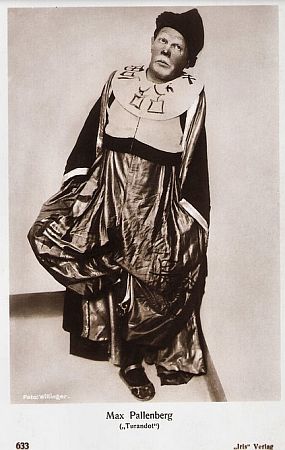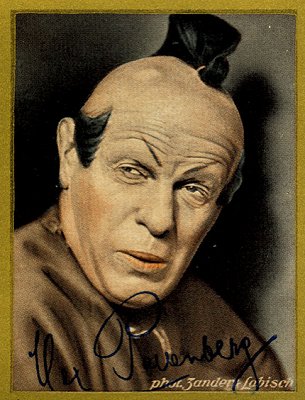Nach Lehrjahren in der österreich-ungarischen1)
Provinz kam der der aufstrebende Schauspieler über Linz1) (1902),
Olmütz1) (1903/04;
heute: Olomouc, Tschechien) und Bad Ischl1)
in seine Geburtsstadt zurück und erhielt 1904 an dem von Josef Jarno1)
(1866 – 1932) geleiteten "Theater in der Josefstadt"1)
ein Engagement, trat 1905 zudem an dem angeschlossenen "Lustspieltheater"2)
auf. Rasch entwickelte er sich zu einem brillanten Charakterkomiker, bereits
wenige Jahre später gehörte er zu den Operetten-Stars des "Theaters an der Wien"1),
trat unter anderem als Fürst Basil Basilowitsch in der Uraufführung
(12.11.1909) der Operette "Der
Graf von Luxemburg"1) von Franz Lehár1) auf; zur Spielzeit 1910/11
war er auch am "Deutschen Volkstheater"1) tätig. Seit 1911
wirkte Pallenberg in München am "Deutschen Künstlertheater"1),
wo er in den Inszenierungen von Max Reinhardt1)
(1873 – 1943) in dessen Inszenierungen der Operetten "Orpheus in der
Unterwelt"1) und "Die schöne
Helena"1) von Jacques Offenbach1) als Jupiter1)
bzw. Menelaos1) großen Beifall fand.
Ebenfalls 1911 erregte er in der Londoner "Olympia
Hall"1) Aufmerksamkeit in Reinhardts
Uraufführung (23.12.1911) des auf
einer mittelalterlichen Marienlegende basierenden Werks "Das
Mirakel"1) von Karl Gustav Vollmoeller1),
in dem er mit dem
Part des dämonischen Spielmannes auftrat → Foto bei flickr.com.
Ab 1914 wurde Berlin Max Pallenbergs künstlerische Heimat, dort
stand der meisterliche Mime überwiegend am "Deutschen Theater"1)
bei Max Reinhardt auf der Bühne, machte aber auch an Revue-Theatern und
Operettenhäusern Furore.
In Berlin lernte er auch seine spätere Ehefrau, die berühmte
Operetten-Diva Fritzi Massary
(1882 – 1969) kennen und lieben – das Paar heiratete am
20. Februar 1917 im Berliner Ortsteil Charlottenburg1).
Foto: Max Pallenberg 1909
Quelle: Alte Künstlerkarte; Urheber unbekannt
von Wikipedia
bzw. Wikimedia
Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
 |
Schon früh feierte Pallenberg Erfolge, war berühmt dafür, klassische Texte zu modernisieren
und umzuwandeln, diese in einem ganz eigenen, oft aggressiven Stil vorzutragen, ähnlich einem
Klaus Kinski
(1926 – 1991) in späteren Jahren. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky1) beschrieb Max Pallenberg einmal als "ein Teufel, ein entgleister Gott, ein
großer Künstler", Pallenberg selbst sagte über seine Darstellungen
"Das Weinen ist dem Menschen angeboren, aber das Lachen will gelernt sein".
Seine Komik war bestechend, am "Deutschen Theater" galt der Künstler als
"komischster Komiker" seiner Zeit, so versetzte er beispielsweise als Böhme Zawadil in
dem Schwank "Familie Schimek" von Gustav Kadelburg1)
(Regie: Emil Jannings) täglich Zuschauer und Mitspieler in so unbeschreibliche Lachlust, dass
das Spiel auf der Bühne minutenlang aussetzen musste, damit die Leute sich wieder sammeln konnten.
Pallenberg wurde als der reiche Gutsbesitzer Herr von Rappelkopf in dem
Zauberspiel "Der
Alpenkönig und der Menschenfeind"1) (1914/15)
von Ferdinand Raimund1) ebenso
bejubelt wie als der
Protagonist Harpagon in der Moličre-Komödie "Der
Geizige"1) (1917) oder als Tobias Buntschuh
in dem als "burleske Tragödie" bezeichneten, gleichnamigen Stück (1917)
von Carl Hauptmann1).
An weitere herausragenden Interpretationen sind zu nennen der Rentier Krüger in
der Diebeskomödie"Der
Biberpelz"1) (1916) von Gerhart Hauptmann1),
der Hilfsschreiber Wilhelm Foldal in dem Ibsen-Drama "John Gabriel Borkman"1) (1916), der Ergast in
dem Einakter"Die Lästigen"1),
der von Hugo von Hofmannsthal1) nach Moličres
Comédie-ballet1)
"Les Fâcheux"1)
entstand und am "Deutschen Theater" unter der Regie von Max Reinhardt am 26. April 1917 zur Uraufführung gelangte, oder als Moličre-Interpret der Bürger Jourdain
in "Der Bürger als
Edelmann"1) (1918),
ebenfalls in einer Bearbeitung von Hugo von Hofmannsthal.
Max Pallenberg 1917 in der Rolle des Tobias Buntschuh
Urheber: Fotoatelier "Zander & Labisch"
(Albert Zander u. Siegmund Labisch1) (1863–1942))
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
In der Uraufführung (16.03.1923) des Lustspiels
"Der
Unbestechliche"1) von Hugo von Hofmannsthal1)
brillierte er unter anderem am Wiener "Raimund-Theater"1)
mit der Hauptrolle des unbestechlichen Dieners Theodor oder ein Jahr später am "Deutschen
Theater" in dem Stück "Sechs Personen suchen einen Autor"1)
von Luigi Pirandello1)
als der Theaterdirektor. Weitere Glanzrollen des Charakterkomikers waren
beispielsweise die des Schluck in der Komödie "Schluck und Jau"1)
von Gerhart Hauptmann1)
und die des "Bettlerkönigs" Peachum in "Die
Dreigroschenoper"1) von Bertolt Brecht/Kurt Weill1). Auch auf ausgedehnten,
internationalen Gastspielreisen zeigte Pallenberg seine Kunst. Er
begeisterte mit Titelrollen in Stücken wie"Liliom"1) (1922)
von Ferenc Molnár1)
oder in der 1928 von Erwin Piscator an der
Berliner "Piscator-Bühne"1)
inszenierten Aufführung von "Die Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk", Max Brods1)
und Hans Reimanns1) Bühnenadaption des
antimilitaristisch-satirischen, gleichnamigen
Schelmenromans1) von Jaroslav Hašek1)
(1883 – 1923) – eine seiner Paraderollen. 1929 gestaltete
Pallenberg den Bankdirektor Norrison in dem amüsanten Stück "Eins, zwei,
drei" von Ferenc Molnár und den Komponist Zamrjaki in
dem Hochstaplerstück "Der Marquis von Keith"1) von
Frank Wedekind1).
Diese letztgenannte Aufführung fand am 28. März 1929 im Berliner "Schauspielhaus am Gendarmenmarkt"1)
zu Ehren des am 10. Februar 1929 mit nur 56 Jahren plötzlich
verstorbenen Schauspielers Albert Steinrück statt,
Heinrich George
organisierte diese von Leopold Jessner1) inszenierte "Albert Steinrück
Gedächtnisfeier" bzw. Benefiz-Veranstaltung mit sich in der
Titelrolle, um Steinrücks Witwe finanziell zu unterstützen. Da das
Schauspiel selbst gar nicht für viele Rollen ausgelegt ist, erfand man
kurzerhand eine Vielzahl von "Statistenrollen", etliche der
teilnehmenden Künstler/-innen gingen als Gäste des Marquis von Keith
einfach nur stumm über die Bühne. Die Liste der insgesamt 86 Mitwirkenden
liest sich wie das "Who is Who" der Berliner Theater- und
Filmszene, angefangen von Hans Albers
(Kellner) über weitere Stars wie Maria Bard
(Freifrau von Rosenkron), Elisabeth Bergner
(Freifrau von Totleben und Laufbursche Sascha), Mady Christians
(Frau Krenzl), Marlene Dietrich,
Tilla Durieux
(Gräfin Werdenfels), Fritz Kortner
(Metzgerknecht), Fritzi Massary
(stumme Dienstmädchen), Werner Krauß
(Konsul Casimir), Hermann Vallentin
(Kriminalkommissar Raspe), Paul Wegener
(Metzherknecht) bis hin zu Wolfgang Zilzer.
Zum "Ehrenausschuss" gehörten unter anderem der Physiker Albert Einstein1),
der Maler Max Liebermann1),
der Theatermann Max Reinhardt1),
der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß1)
und Reichstagspräsident Paul Löbe1)
→ mehr bei cyranos.ch (Aushang). Kein geringerer als der Schriftsteller Heinrich Mann1)
sprach die Gedenkworte, im "Ifflandsaal" des Hauses wurden Steinrücks Bilder ausgestellt bzw. zum Verkauf angeboten.
|
Das Publikum der "Salzburger Festspiele"1) konnten Pallenberg
ebenfalls jeweils in den Inszenierungen von Max Reinhardt für sich einnehmen, trat hier erstmals 1923
als Protagonist Argan in der Moličre1)-Komödie "Der eingebildete Kranke"1)
in Erscheinung, unter anderem gab Nora Gregor Argans Frau Béline,
Alma Seidler1) deren Tochter Angelique,
Hans Brausewetter Angeliques Geliebten Cléante und
Hansi Niese das Dienstmädchen Toinette.
1926 gehörte er neben Alexander Moissi in der
Titelrolle und u. a. Dagny Servaes
(Buhlschaft) als "der Teufel" zur Besetzung des Traditions-Stücks "Jedermann"1) von
Hugo von Hofmannsthal1), gab
ebenfalls 1926 den obersten Eunuchen Truffaldino in dem tragikomischen
Märchen "Turandot"1) von
Carlo Gozzi1)
mit Helene Thimig als Turandot, Prinzessin von China bzw. Tochter des Kaisers Altum
(Gustav Waldau).
Dann vergingen einige Jahre, bis man Pallenbergs Kunst wieder in Salzburg
bewundern konnte, 1933 brillierte mit der Figur des Mephistopheles in der
Goethe-Tragödie "Faust I"1) an
der Seite von Ewald Balser
in der Rolle des Faust, Paula Wessely als Gretchen und
Lotte Medelsky1) als Marthe Schwerdtlein.
Max Pallenberg 1926 bei den "Salzburger Festspielen"
als Traffaldino in "Turandot", fotografiert von
von Wilhelm
Willinger1) (1879 – 1943)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
"Iris Verlag" Nr. 633
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
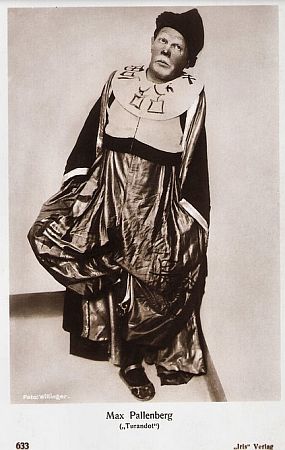
|
Ingeborg Liane Schack schreibt in "Neue
Deutsche Biographie"*):
"Der Improvisationskunst Pallenbergs wegen einzigartig in der Theatergeschichte blieb seine Gestaltung des
"Eingebildeten Kranken" in der Inszenierung Max Reinhardts auf
Schloß Leopoldskron1) bei Salzburg 1923:
Pallenberg, der die Zuschauer im Foyer einzeln willkommen hieß, spielte sich allmählich
auf die Bühne, wo er sich ermattet in seinen Krankensessel sinken ließ und mit
dem Text Moličres begann."
Auf der Leinwand erschien Pallenberg eher selten, im Stummfilm hatte er bereits 1912
erste Auftritte in den
ganz auf ihn zugeschnittenen, von Alexander Kolowrat-Krakowsky1) gedrehten, kurzen Streifen "Pampulik als Affe",
"Pampulik kriegt ein Kind" und "Pampulik hat Hunger".
Von (Regie/Produktion) Heinrich Bolten-Baeckers1) entstanden 1915 die Geschichten "Max und seine zwei Frauen", "Der rasende Roland"
und
"Kapellmeisters Pflegekind"1).
|
In letztgenanntem Melodram präsentierte er sich als der Kapellmeister
Raninger, der durch einen Zufall in den "Besitz" eines kleinen
Mädchens gerät und sich liebevoll um seine Ziehtochter kümmert. So
schrieb die "Kinematographische Rundschau"1)
(21.03.1915, S. 42) unter anderem: "Die österreichisch-ungarische
Gaumant1)-Gesellschaft
hat einen Film erworben, den Bolten-Bäckers inszeniert hat und in dem Max Pallenberg, einer größten Lieblinge
des Wiener Theaters der letzten Jahre, die Hauptrolle spielt. Die Behauptung, dass Pallenberg ein
ausgesprochener Komiker ist, ist nicht richtig. Das Wiener Publikum kennt ihn auch von der ernsten Seite
und ehe er ein Star der Operettenbühne war, war er bereits der Künstler, der in Schauspielen feinhumoristische
und ebenso gemütvolle Rollen zu verkörpern wusste, die die Grundlage seiner Beliebtheit bildeten und ein
stärkerer Gradmesser seiner Kunst waren, als die späteren Erfolge in der Operette. Es gibt viele, die
ihm diesen Schritt nicht verzeihen konnten. Mit diesen begrüßen
auch wir es, daß Pallenberg sich für den Film einen jener Rollen gewählt
hat, die durch eine ungemein sympathische, gemütvolle Innerlichkeit glänzen,
nicht in der tiefen Tragik untergehen und dabei wie ein Irrlicht den
leisen Humor der Behaglichkeit durchglänzen lassen." → online
anno.onb.ac.at
Max Pallenberg auf einem Sammelbild aus der Serie
"Bühnenstars und ihre Autogramme", die 1933 den "Gold-Saba"-Zigaretten
der "Garbaty"1)-Zigarettenfabrik
von Josef Garbáty1)
beilagen.
Urheber: Fotoatelier "Zander & Labisch"
(Albert Zander u. Siegmund Labisch1) (1863–1942))
Quelle: Wikimedia
Commons; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
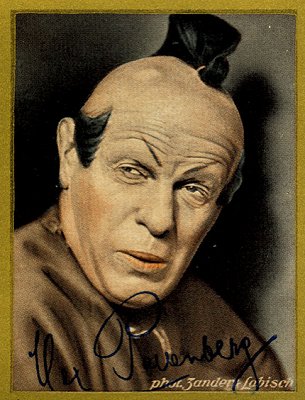
|
| Danach trat Pallenberg nur noch in einem Stummfilm in
Erscheinung, mit ihm als Lord Cunterby und unter anderem Ria Jende als Lady Cunterby
drehte Adolf Abter1)
den Streifen "Die Nacht und der Leichnam" (1920).
Pallenbergs einziger Tonfilm war unter der Regie von Fritz Kortner
die Komödie "Der brave Sünder"1) (1931)
nach dem Roman "Die Betrüger" von Walentin Petrowitsch Katajew1)
bzw. dem darauf basierenden Theaterstück "Die Defraudanten"
von Alfred Polgar1), der auch gemeinsam mit
Kortner das Drehbuch schrieb: Hier zeigte er sich als der
grundehrliche Hauptkassierer und sittenstrenge Familienvater
Leopold Pichler, dessen Tochter Hedwig (Dolly Haas)
sich in Pichlers Gehilfen Karl Wittek (Heinz Rühmann) verliebt.
Als Pichler und Wittek dem gerade abgereisten Bankdirektor (Ekkehard Arendt1)) eine Geldsumme
übergeben wollen, geraten beide in der Großstadt in ungeahnte
Turbulenzen. Mimisch, sprachlich und schauspielerisch
wird dieser Streifen von Max Pallenberg dominiert, der in einer Szene bemerkt:
"Wo wir sind, ist Büro. Büro ist kein Lokal. Büro ist ein geistiger Zustand."
Diese Figur hatte Pallenberg bereits zuvor an der Berliner
"Volksbühne"1) in der
von Karlheinz Martin1)
inszenierten Uraufführung (12.12.1930) von "Die Defraudanten"gestaltet,
zur Besetzung gehörten Therese Giehse,
Ernst Ginsberg1),
Leonard Steckel und
Karl-Heinz Stroux1 → Übersicht Filmografie.
|
Mit der so genannten "Machtergreifung"1) der
Nationalsozialisten verließ Pallenberg 1933, wie viele andere
jüdische Künstler, gemeinsam mit seiner Ehefrau Fritzi Massary Berlin und ging zunächst
in seine österreichische Heimat zurück. Nur ein Jahr später
starb er
am 26. Juni 1934 mit nur 56 Jahren auf tragische Weise: Das Flugzeug, welches
ihn nach Prag bringen sollte, stürzte in der Nähe von Karlsbad1)
(heute Karlovy
Vary, Tschechien) ab. Es heißt, er habe
sein Ticket für den Fünf-Uhr-Flug gegen ein Ticket für einen früheren
Flug umgetauscht; während der späte Flug pünktlich sein Ziel erreichte, stürzte die Maschine mit Max Pallenberg ab.
Die Urne mit seinen sterblichen Überresten wurde in dem Urnenhain der
"Feuerhalle Simmering"1) (Abteilung ML, Gruppe 16, Nummer 1G)
im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering1) beigesetzt → Foto der
Grabstätte bei knerger.de
sowie
Wikimedia Commons. Pallenbergs Witwe Fritzi Maasary überlebte
ihren Ehemann um mehr als drei Jahrzehnte und starb am 30. Januar 1969
86-jährig im kalifornischen Beverly Hills1) (USA),
Noch heute sind einige Schallplatten, überwiegend Ensembleszenen, mit
Pallenberg erhalten, aber auch Lieder wie das Couplet "Mein Freund, der
Löbl" aus der Operette "Ein
Herbstmanöver"1) von Emmerich Kálmán
→ youtube.com.
Seit 1955 trägt die vormalige "Alleestraße" als "Pallenbergstraße" im 13. Wiener
Gemeindebezirk Hietzing1)
seinen Namen.
Max Pallenberg, 1930 fotografiert ;von Fritz
Eschen1) (1900–1964)
Quelle: Deutsche
Fotothek, (file: df_e_0050521);
© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Fritz Eschen
Urheber: Fritz Eschen; Datierung: 1930;
Quelle:
www.deutschefotothek.de;
Genehmigung zur Veröffentlichung:
30.03.2017
|
 |
|