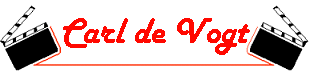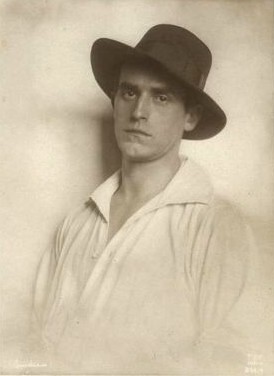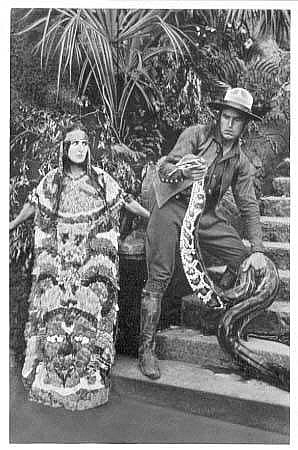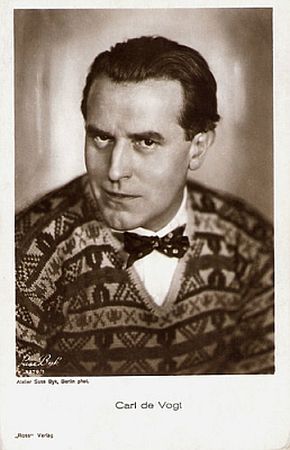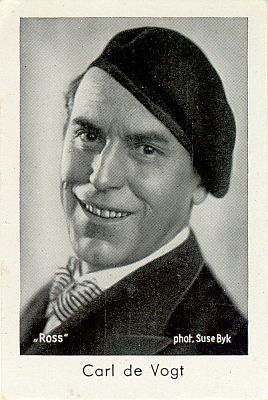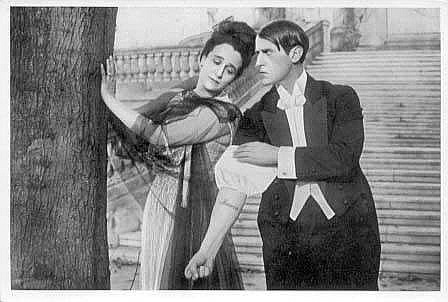|
Carl de Vogt wurde am 14. September 1885 als Carl Bernhard de Vogt in
Köln1) geboren,
verbrachte dort auch seine Kindheit und Jugend;
sein Vater Balthasar de Vogt war von Beruf Schriftsetzer.
Nach dem Besuch der Volksschule trat Sohn Carl in die Fußstapfen seines
Vaters und machte zunächst eine Lehre als
Buchdrucker, entschied sich dann aber für die Schauspielerei und ließ sich am Konservatorium
seiner Geburtsstadt dementsprechend ausbilden. 1908 schloss er seine Studien,
die auch Gesang und Tanz beinhalteten, ab, erhielt ein erstes Engagement am Kölner
"Residenztheater". Doch die
Bühne wurde bereits drei Monate später aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten geschlossen, Carl de Vogt wechselte zunächst nach Wien an
die Kleinkunstbühne "Cabaret
Fledermaus"1), ging dann nach Mainz,
wo er am "Stadttheater"1) unter anderem auch als Sänger in Operetten wie "Der fidele Bauer"1)
und "Der Graf von Luxemburg"1) sowie in Lustspielen auftrat.
Schließlich wurde Freiburg1) eine weitere Station seiner beginnenden
Schauspielerkarriere, die er jedoch wegen des 1. Weltkrieges, wenn auch nur
kurz, unterbrechen musste. Für mehrere Monate wurde er ab 22. Juli 1915
bis 9. Dezember 1915 an die Front geschickt, doch bereits Anfang 1916
erhielt er in Berlin ein Engagement am "Lessingtheater"1),
wenig später wurde er Mitglied des "Königlichen
Schauspielhauses"1).
Foto: Carl de Vogt um 1920
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: Wikimedia
Commons;
Ross-Karte Nr. 266/4 (Ausschnitt)
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
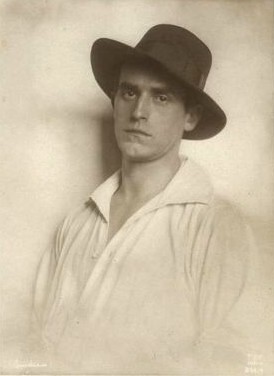 |
 |
Zu dieser Zeit begann Carl de Vogts Arbeit für den Film,
erste
Auftritte hatte er 1916 in den stummen Produktionen "Friedrich Werders Sendung"
in "Die Einsame", "Schwert und Herd"1)
und in "Der Weg des Todes"1).
In der Folgezeit stand er – oft mit
Carola Toelle
(1893 – 1958) als
Partnerin – in zahlreichen weiteren Geschichten als Hauptdarsteller vor der
Kamera der noch jungen Berliner "Bioscop-Filmgesellschaft". Bereits mit einem
seiner frühen Filme, dem von Otto Rippert1)
nach dem Roman von Hugo Landsberger1) alias Hans Land
in Szene gesetzten Streifen "Friedrich Werders Sendung" (1916),
wurde der Schauspieler populär und avancierte mit der Titelrolle zum Star der
Stummfilm-Szene: Die Geschichte thematisierte einen Vater-Sohn-Konflikt, Friedrich Werder findet heraus,
dass sein eigener Vater ein Verbrecher war und erkennt
in der Laufbahn seines Sohnes (Theodor Loos) wiederum den Vater.
"Der
Kinematograph"1)
(Nr. 525) vom 17.1.1917 schrieb damals: "Herr de Vogt vom Kgl. Schauspielhaus
trat mit der Titelrolle zum ersten Male in einer großen Aufgabe vor das Publikum.
Sein Erfolg war stark. Er scheint eine Persönlichkeit zu sein. Ihm gelang
der Ausdruck des nach seiner Herkunft verzweifelt Suchenden außerordentlich, und
das Zeichen des unglücklichen Menschen und Vaters lag über ihm."
Carl de Vogt auf einer Künstlerkarte (Film-Sterne 223/1),
aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin
(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))
Quelle: virtual-history.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
Bis etwa 1918 arbeitete Carl de Vogt für die "Deutsche Bioscop GmbH",
war deren Hauptdarsteller in rund 15 Produktionen, die meist von Robert Reinert1) (1872 – 1928) gedreht
wurden. So als Protagonist Ahasver1) in dem
gleichnamigen Dreiteiler1) (1917),
welcher 1920 dann auch in einer einteilige Fassung in die Lichtspielhäuser
gelangte.
Ebenfalls 1917 entstand das zweiteilige Werk "Der Herr der Welt"
("Liebe"/"Der lebende Tote"),
das wie viele andere Filme de Vogts als verschollen gilt. Carl de Vogt als Träger
der Hauptrolle und seine Partnerin Carola Toelle geben in diesem Film ihre
darstellerische Kunst und bringen ihre Aufgabe in einer Form zur Durchführung, die vollste Anerkennung
verdient, so nachzulesen in "Lichtbild-Bühne"1) (Nr. 51) vom
22.12.1917. Nach "Das Licht des Lebens" (1918), "Der Mann im Mond" (1918)
und "Die Beichte des Mönchs" (1918) folgte mit dem als
"Ein Detektivroman " untertitelten Streifen "Kassenrevision" (1918) der Auftakt zu einer kleinen "Carl-de-Vogt-Serie",
die mit dem vierten Film "Olaf Bernadotte" (1919), der Läuterungsgeschichte
eines jungen Tunichtguts, beendet wurde.
Carl de Vogt betätigte sich nun ausschließlich beim Film,
am Theater war er Anfeindungen
ausgesetzt gewesen, die Kritiker attestierten ihm vor allem nach seinem
Auftritt in der Shakespeare-Tragödie "Othello"1) bzw. seiner Interpretation des Jago nur "Mittelmaß": Herr de Vogt ist ganz
altes Theater; Verharren im Wohllaut; jede Silbe ein Akzent; auch im Nebensächlichen
"bedeutend"; kein Sinn für den Humor der Rolle; ein ganzer Bühnenteufel; gar kein
Mensch. urteilte ein Kritiker am 6.12.1918 im "Berliner Tageblatt"1).
Die "Vossische Zeitung"1) schrieb am
selben Tage: Er spielte eigentlich
mehrere Jagos: einen Gymnastiker, der über Tische springt und sich wie ein
tanzender Derwisch um die eigene Achse dreht, einen Biedermeier, dem der
Untergrund der Bosheit fehlte, und zwischendurch wohl auch die gegebene Gestalt, den lauernden Schurken in der Maske der
Treuherzigkeit.
Beim Film war und blieb Carl de Vogt als Naturbursche und Abenteurer der
Star und Liebling des Publikums,
drehte beispielsweise mit Regisseur Fritz Lang1)
und Ressel Orla
als Partnerin das exotische Drama "Halbblut"1) (1919) sowie
zusammen mit Gilda Langer das spektakuläre, erotische Rührstück "Der Herr der Liebe"1) (1919),
welches die Eskapaden eines sexhungrigen ungarischen
Edelmanns erzählte, der am Ende von seiner Geliebten (Gilda Langer) betrogen wird,
sie erwürgt und sich erschießt. Karl de Vogt bringt für die
Hauptrolle die imposante Erscheinung und seine
männlich-kraftvolle schauspielerische Ausdrucksfähigkeit
mit. ("Film-Kurier"1), Nr. 96, 26.9.1919). Brutalität und Sinnlichkeit spiegeln sich trefflich in seinen
Mienen. ("Der Film", Nr. 39, 27.9.1919).
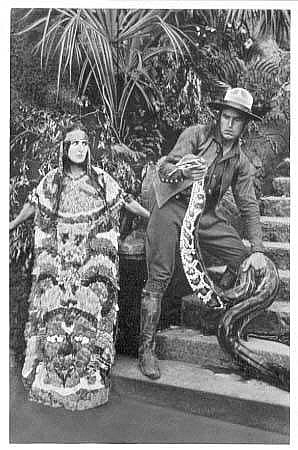
|
Eine weitere Zusammenarbeit mit Fritz Lang fand mit dem zweiteiligen
Abenteuerzyklus "Die Spinnen"1) (1919/1920)
statt, einer Mischung aus Western und Krimi.
Fritz Lang selbst hatte das Drehbuch geschrieben,
Carl de Vogt mimte den Sportler, Abenteurer und Weltenbummler Kay Hoog, der,
dem Hilferuf einer Flaschenpost folgend, einem sagenhaften Schatz aus dem Reich der
Inka nachjagt und dabei gegen die Verbrecherorganisation
"Die Spinnen" kämpft, die von der rassigen und gefährlichen Lio Sha
(Ressel Orla) angeführt wird. Die ursprünglich auf vier Teile ausgelegte
Geschichte fand mit den Episoden "Der Goldene See"2) und "Das Brillantenschiff"2)
ein vorzeitiges Ende, da Fritz Lang sich von der "Decla-Bioscop
A.G."1) getrennt
hatte.
Carl de Vogt als Kay Hoog und Lil Dagover als Sonnenpriesterin Naela
in dem Stummfilm "Der goldene See" (1919), 1. Teil des Filmzyklus
"Die Spinnen",
von Fritz Lang gedreht für die "Decla-Film"
Quelle: Deutsche
Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000838)
aus "Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film"
von Dr. Oskar Kalbus (Berlin 1935, S. 49) / Sammelwerk Nr. 10 bzw. Ross-Verlag 1935
© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf
Quelle: www.deutschefotothek.de; Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017
|
Carl de Vogt drehte mit anderen Regisseuren, unter anderem mit Johannes Guter1),
Hans Werckmeister1),
Reinhard Bruck1) und
Arthur Günsburg1), trat beispielsweise 1920 als
Kara
Ben Nemsi1)
zusammen mit Meinhart Maur1) (Hadschi Halef Omar1))
in der Karl May1)-Trilogie "Auf den Trümmern des Paradieses"1), "Die Todeskarawane"1)
und "Die Teufelsanbeter"1) auf, die
Josef Stein1) bzw.
Marie-Luise Droop1)
realisiert hatte. In den beiden erstgenannten Abenteuern war die aus
Vorpommern stammende Claire Lotto1)
(1893 – 1952) de Vogts Partnerin, aus der beruflichen Zusammenarbeit ergab
sich eine private, das Paar heiratete am 14. Oktober 1922 und stand bis
Ende der 1920er Jahre
noch für zahlreiche weitere Filme gemeinsam vor der Kamera.
Zu Carl de Vogts weiteren Stummfilmen zählen unter anderem
der Krimi "Die
Dreizehn aus Stahl"1) (1921), der Zweiteiler
"Die Schatzkammer im See" (1921), die "Raubtierfilm"-Reihe
"Der Herr der Bestien" (1921), "Die Schreckensnacht in der Menagerie" (1921),
"Unter Räubern und Bestien" (1921), "Die Tigerin"1) (1922),
"Allein im Urwald" (1922, auch "Die Rache der Afrikanerin")
und "Die
weisse Wüste"1) (1922), alle von
Ernst Wendt1) in Szene
gesetzt und mit Ehefrau Claire Lotto als Partnerin. Der athletische Carl de Vogt
drehte alle Stunts selbst, soll innerhalb des Löwenkäfigs von einem
drei Meter hohen Felsen über ein Gebüsch hinweg in das eiskalte Wasser springen,
während von rückwärts, ohne irgend welchen Schutz, ihn sechs Löwen attackieren, die
möglichst auf einen Meter an ihn herankommen sollen, während zu gleicher Zeit vor ihm
auf einer Steinplatte im Wasser ein 3,50 Meter langes Krokodil
lauert. ("Film-Kurier"1), Nr. 248, 24.10.1922).
|
Erwähnenswert ist
jedoch auch seine Darstellung des Malers Rembrandt van Rijn1) in Arthur Günburgs
Biopic "Die Tragödie eines Großen" (1920),
sein Tempelherr in Manfred Noas1)
Adaption "Nathan der Weise"1) (1922)
nach dem gleichnamigen
Drama1) von Gotthold Ephraim Lessing1)
mit Werner Krauß in der Titelrolle,
der Hektor1) in
Noas zweiteiligem "Helena"1)-Epos "Der Raub der Helena"2) und "Der Untergang Trojas"2)
(beide 1924) Edy Darclea (1895 – ?) als die schöne Helena1)
sowie der Kaiser Napoleon III.1)
in den mit Franz Ludwig als Otto von Bismarck1) realisierten
Historienfilmen "Bismarck"1) (1925)
und "Bismarck 1862–1898"1) (1926).
Erfolgreich war auch Rolf Randolfs1) Detektivstreifen "Der Bettler vom Kölner Dom"1) (1927), die Geschichte einer internationalen Einbrecherbande,
die als Bettler verkleidet in Köln ihr Unwesen treiben: "Carl de Vogt ist der dämonische Verbrecher. Er stellt
den Bettler in einer kühn erschauten Maske dar, mit Glatze und strähnigem Seitenhaar, Brille, Radmantel und
Krücke", schrieb die "Lichtbild-Bühne"1) (Nr. 205,
27.8.1927); in "Der
Kinematograph"1) (Nr. 1071, 28.8.1927)
las man: "Carl de Vogt erwies
sich als Bettler vom Kölner Dom als ein ausgezeichneter Maskenkünstler.
Dieser eine Zeitlang nicht recht wirksame Schauspieler ist auf dem besten Wege, ein deutscher Lon Chaney zu
werden. Eine digital restaurierte Fassung dieses
rasanten Stummfilms mit Carl de Vogt in der Titelrolle und Henry Stuart als
Interpol-Inspektor Tom Wilkins bzw. "Mann der tausend Verkleidungen und Masken" ist
inzwischen im Handel erhältlich → edition-filmmuseum.com.
Carl de Vogt, fotografiert von Suse
Byk1) (1884 – 1943)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Ross-Karte Nr. 3279/1
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
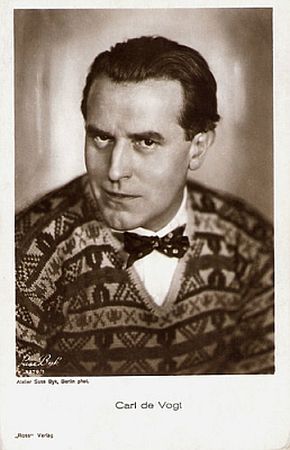 |
Danach ging Carl de Vogts Karriere als "Draufgänger"
und Filmheld zu Ende, im
Tonfilm konnte er an seine alten Erfolge nicht mehr anknüpfen und wurde meist
nur noch in Nebenrollen besetzt, von denen jedoch einige durchaus prägnant
waren: In der amüsanten Geschichte "Lumpenball"1) (1930) mimte er einen Rechtsanwalt,
in "Flachsmann
als Erzieher"1) (1930) nach dem Bühnenstück von Otto Ernst1) neben
"Titelheld" Paul Henckels den Lehrer Bernhard Vogelsang
und in der mit Gustaf
Gründgens gedrehten Gaunerkomödie "Teilnehmer antwortet nicht"2) (1932)
einen Kommissar. Seine einzige Hauptrolle in Tonfilm blieb die des Patrioten und
Freiheitskämpfers Ferdinand von Schill1) in
Rudolf Meinerts1) Spielfilm "Die elf
Schill’schen Offiziere"1) (1932).
Man sah Carl de Vogt unter anderem als Antoine Pesne1), seit 1722 Direktor der "Berliner
Kunstakademie"1), in dem so
genannten Fridericus-Rex-Film1)
"Die
Tänzerin von Sanssouci" (1932) mit Otto Gebühr als
Preußenkönig Friedrich II.1)
und Lil Dagover als Tänzerin Barberina Campanini1), als
Konrad Baumgarten, Landsmann aus Unterwalden, in "Wilhelm Tell"1) (1934) mit Hans Marr
als Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell1) und Conrad Veidt als dessen Gegenspieler Reichsvogt Gessler
oder in der mit Sybille Schmitz in der
Titelrolle gedrehten, mystischen Filmlegende "Fährmann
Maria"1) (1936) als den romantischen Geiger und Sänger, der durch das Moor wandelt.
Nach seinem Part eines Rechtsanwalts in der Komödie "Rheinische
Brautfahrt"2) (1939) beendete Carl de Vogt
vorerst seine Tätigkeit für den Film.
Trotz seiner Zugehörigkeit zur NSDAP1) (seit 1933)
sowie der NSBO1)
und der SA1)
erhielt der Schauspieler keine weiteren Aufgaben im Film, hielt sich nun unter anderem mit Arbeiten für die Synchronisation
ausländischer Filmproduktionen über Wasser oder und wirkte mit Soloprogrammen bei der Truppenbetreuung
mit.
Nach Kriegsende wurde der Schauspieler 1945 zunächst mit einem Auftrittsverbot belegt, erhielt
später noch kleinere Bühnenengagements in Potsdam und Berlin. Seit den 1950er Jahren stand er wieder sporadisch mit
kleinen, unbedeutenden
Nebenrollen vor der Kamera. So unter anderem für den Rühmann-Film "Briefträger Müller"1) (1953),
das Lustspiel "Die
sieben Kleider der Katrin"1) (1954)
oder die Krimis "Banktresor 713"1) (1957), "Das
Geheimnis der schwarzen Koffer"1) (1962) und "Die Unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse"1) (1962).
Der Bryan Edgar Wallace1)-Thriller "Der Würger von Schloß Blackmoor"1) (1963) war
seine letzte Arbeit für den Kinofilm → Übersicht Tonfilme.
Darüber hinaus wirkte er noch in zwei TV-Produktionen mit, als Hausdiener
Jakob in der Adaption "Dumala"3) (1963) nach
dem gleichnamigen Roman1) von Eduard Graf von Keyserling1) an der
Seite von Rudolf Fernau (der alte Baron Werland, Herr auf Schloss Dumala), Margot Trooger (dessen
Gattin Karola), Heinz Weiss (Pastor Erwin Werner)
und Albert Lieven
(Baron Behrent von Rast) sowie als Gerichtsdiener in dem Stück "Ein Windstoß" (1963) nach dem Lustspiel "Un colpo di vento"
von Giovacchino Forzano1).
Nicht nur als Stummfilmstar machte sich Carl de Vogt einen Namen,
auch als Rezitator und Sänger konnte er mit seiner kräftigen Baritonstimme
Erfolge verzeichnen. Einige seiner Lieder wie
der Foxtrott "Trude, Trudelchen" oder seine Rezitation
über den "Fremdenlegionär" nach dem gleichnamigen Melodram von
Hermann Mestrum und Gerhard Ebeler1), sind bis heute erhalten
geblieben → Tondokumente
bei Wikipedia.
Vereinzelt war er zudem an Hörspielproduktionen beteiligt.
Der einstige Stummfilmstar Carl de Vogt starb am 16. Februar 1970 – von den
Medien fast unbeachtet – im Alter von 84 Jahren in einem Berliner
Altersheim; dort war er gelegentlich noch als Sänger mit seiner Laute aufgetreten.
Er war zwei Mal verheiratet, in erster Ehe mit der ebenfalls in Köln
geborenen Opernsängerin Elsa Jülich1) (1886 – 1964),
die nach der Scheidung später den Korrepetitor und Kapellmeister Michael Taube1) (1890 – 1972)
heiratete. Aus der Verbindung mit Jülich ging die um 1913 geborene
Tochter Ruth de Vogt hervor, die nach Ende des 2. Weltkrieges unter
ihrem Ehenamen "Ruth Bruck" als Chanson- bzw. Jazzsängerin bekannt
wurde → grammophon-platten.de, sowie Sohn Karl Franz de Vogt (1917 – 1999), der später als Filmproduzent tätig
war.4) Am 14. Oktober 1922 heiratete de Vogt seine Kollegin Claire Lotto1),
die bereits Ende August 1952 verstarb.
|

|
Quellen: CineGraph – Lexikon
zum deutschsprachigen Film"*) sowie
Wikipedia,
cyranos.ch, filmhistoriker.de
Fotos bei virtual-history.com,
filmstarpostcards.blogspot.com
|
*) CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film, Lieferung 39
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) filmportal.de, 3) Die Krimihomepage
4) Quelle: Wikipedia
(Artikel zu Elsa Jülich)
Lizenz Foto Carl de Vogt (Urheber Alexander Binder/Suse Byk): Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen
und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.
Lizenz Foto Carl de Vogt (Urheber: Fotoatelier
Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) / Heinrich
Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,
weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das
Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen
Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.
|

|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database,
filmportal.de
sowie
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"
(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia, Murnau
Stiftung; R = Regie)
|
Stummfilme (Auszug)
- 1916: Friedrich Werders Sendung
(nach dem Roman von Hugo
Landsberger alias Hans Land; R: Otto
Rippert;
als Friedrich Werder) → Early Cinema Database
- 1916: Die Einsame
(R: Fred
Sauer (auch Darsteller); mit Hermine
Körner; als ?)
- 1916: Schwert und Herd
(R: Georg Victor Mendel;
als Wilhelm Trautmann, der Schmied)
- 1916: Der Weg des Todes
(R: Robert
Reinert; als der Graf (Rollenzuordnung
unsicher), Gatte von Marie (Maria
Carmi))
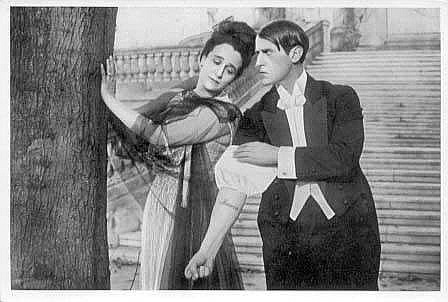
|
Maria Carmi als Gräfin Marie
und Carl
de Vogt
als ihr Gatte?
in dem Ufa-Stummfilm
"Weg des Todes" (1916)
von (Regie) Robert Reinert
Quelle: Deutsche
Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000861)
aus "Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film"
von Dr. Oskar Kalbus1) (Berlin 1935, S. 26)/
Sammelwerk Nr. 10 bzw. Ross-Verlag 1935)
©/Rechteinhaber SLUB Dresden/Deutsche Fotothek
Unbekannter Fotograf
Quelle: www.deutschefotothek.de;
Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017
→ filmportal.de
|
- 1917: Wenn Tote sprechen
(R: Robert
Reinert; als Edgar von Radowitz, Gemahl von Leonore (Maria Carmi))
- 1917: Der Knute entflohen
(R: Josef
Stein; als Bräutigam Walter Fuchs, Carola Toelle
als Braut Maria)
→ Early Cinema Database
- 1917: Ahasver
(R: Robert Reinert; als der "ewige Jude" Ahasver)
- 1917: Erloschene
Augen. Tragödie eines blinden Kindes (R: Josef Stein;
als Graf Wartenburg, Carola Toelle als Maria)
- 1917(18: Der Herr der Welt (R: Robert Reinert; als Graf
Latour sowie dessen Sohn; mit Carola Toelle)
- 1918: Der Weg der Erlösung (R: Josef
Stein; als ?) → Early Cinema Database
- 1918: Das Licht des Lebens (R: Josef Stein; als ?)
- 1918: Der Mann im Monde
(R: Robert Leffler;
als ?)
- 1918: Die Beichte des Mönchs
(R: Robert Leffler; als ?)
- 1918: Die
Kassenrevision (Detektiv-Drama; R: Josef Stein, Adolf
Gärtner; als ?))
- 1919: Olaf
Bernadotte (R: Nils
Chrisander; als ?) → Early Cinema Database,
IMDb
- 1919: Vom Rande des Sumpfes
(nach einer Vorlage von Toni
Attenberger; R: Aruth
Wartan (auch Darsteller);
als Ingenieur Erich Romberg) → Early Cinema Database
- 1919: Die Ehe der Frau Mary
(R: Josef
Coenen; mit Carola
Toelle als Mary Stanley; als deren Ehemann)
→ Early Cinema Database
- 1919: Die Frau mit den Orchideen (R: Otto
Rippert; Drehbuch: Fritz
Lang; als ?; Kurzinfo: über eine Frau (Gilda
Langer),
die einen Mann so leidenschaftlich liebt, dass er ihr Sklave wird, und
sie selbst zum Symbol der Macht des Schicksals.) → IMDb
- 1919: Halbblut
(R: Fritz
Lang; mit Ressel
Orla als die einstige Prostituierte Juanitta, das
"Halbblut", nun verheiratet mit;
Edward Scott (Carl Gebhard-Schröder); als dessen Freund Axel van
der Straaten) → filmportal.de
- 1919: Der Herr der Liebe
(R: Fritz Lang; als Edelmann Vasile Disecu, Gilda
Langer als dessen Geliebte Yvette) → filmportal.de
- 1919/1920: Die Spinnen (R: Fritz
Lang; als der junge Millionär und Sportsegler Kay Hoog)
- 1920: Verfilmung der Vorlagen von Karl May
(als Kara
Ben Nemsi; Meinhart
Maur als Hadschi
Halef Omar)
- 1920: Die Tragödie eines Großen / Rembrandt
(R: Arthur
Günsburg; als Maler Rembrandt van Rijn)
→ Early Cinema Database
- 1920: Die entfesselte Menschheit
(nach dem Roman von Max
Glass; R: Joseph
Delmont; mit Eugen
Klöpfer in der
Hauptrolle des russischen Revolutionärs Karenow; als dessen
Kumpan Bernhard Winterstein)→ filmportal.de
- 1920: Das Fest der
schwarzen Tulpe (nach dem Roman "La
tulipe noire" von Alexandre
Dumas d.Ä.;
R: Muhsin
Ertuğrul, Marie-Louise
Droop (auch Drehbuch); mit Theodor
Becker als Johan
de Witt; als Adrian Witt)→ IMDb
- 1921: Die Dreizehn aus Stahl
(R: Johannes
Guter; als Detektiv Frank Steen) → Murnau Stiftung
- 1921: Klatsch
(R: Josef
Stein; als ?)
- 1921: Die Schatzkammer im See (R: Hans
Werckmeister; als Harry Wills / Bill Jackson)
- 1921: Acht Uhr
Dreizehn. Das Geheimnis des Deltaklubs (R: Hans Werckmeister; als
Fred Hobbing)
- 1921: Der Herr der Bestien
(R: Ernst
Wendt; als Bob Johnson, Privatsekretär des Ölbarons James
Barker)
- 1921: Die Schreckensnacht in der Menagerie
(R: Ernst Wendt; als ?)
- 1921: Planetenschieber
(R: Reinhard Bruck; als ?)
- 1921: Der
Eid des Stephan Huller – Teil 2 (nach dem
Roman von Felix
Hollaender; R: Reinhard Bruck;
als der junge Stephan)
- 1921: Aus dem Schwarzbuche eines Polizeikommissars
- 1921: Erlebnisse einer Sekretärin
(R: Emmerich Hanus; als Olaf Lindborg)
- 1921: Der vergiftete Strom
(R: Urban
Gad; als Pirat Nr. 25)
- 1921–1926: Filme mit Ehefrau Claire
Lotto (auch Cläre Lotto; Heirat am 14.10.1922)
- 1921: Unter Räubern und Bestien
(R: Ernst
Wendt; als ?)
- 1922: Liebes-List und -Lust (R: Reinhard Bruck; als
Dioneo / Bertram / Pyrries)
- 1922: Matrosenliebste (R: Hans
Werckmeister; als Matrose John)
- 1922: Die Stumme von Portici
(nach der Oper "La
muette de Portici" von Daniel-François-Esprit
Auber (Musik);
R: Arthur Günsburg; als Fischer Masaniello, Bruder
der stummen Fenella (Claire Lotto)) → Wikipedia (englisch)
- 1922: Die Tigerin
(R: Ernst
Wendt; Produktion: John
Hagenbeck; als ?)
- 1922: Die Kleine vom Film
(R: Hans
Werckmeister; als Van der Heyt) → IMDb
- 1922: Der Gaukler von Paris
(R: Arthur
Günsburg; als französischen Bandit Cartouche)
- 1922: Es waren zwei Königskinder
(R: Arthur Günsburg; als der König)
- 1922: Die
weisse Wüste (R: Ernst
Wendt; Produktion: John
Hagenbeck; als Sigurd)
- 1922: Allein im Urwald (R: Ernst
Wendt; als Ingenieur Gyldendal) → IMDb
- 1923: Dämon Zirkus
/ Das Todesurteil der Blandin-Truppe (nach dem Roman von Paula
Busch; R: Emil
Justitz;
als ?; Kurzinfo: Ein Dreiecksdrama um die Gunst einer Zirkusbesitzerin hat Konsequenzen. Paula Busch,
die "Grande Dame" des deutschen Zirkus, erzählt eine Geschichte aus der Welt der
Artisten.) → IMDb
- 1923: Lachendes Weinen
(R: Josef
Stein; als ?)
- 1924: Der Schrecken des Meeres
(R: Franz
Osten; als ?)
- 1924: Prater.
Die Erlebnisse zweier Nähmädchen (R: Peter
Paul Felner; mit Henny
Porten als Annemarie,
Claire Lotto als Franzi; als Martin, ein Matrose) → filmportal.de
- 1925: Ballettratten
(R: Arthur
Günsburg; als der König)
- 1925: Durch Sport zum Sieg (Dokumebtarfilm mit Spielhandlung;
R: Alexander Alexander; als Paul, einer der Söhne
des alten Invaliden Karl Werner (Wilhelm
Diegelmann))
- 1925: Die Kleine aus Amerika
(R: Josef Stein; als Lutz Gutzewitt / Marquis Saintbrillant)
- 1925: Am besten gefällt mir Lore
(R: Josef Stein; Claire Lotto als Lore; als Carl, Sohn des
Ehepaares
Funke (Rudolf
Lettinger / Ida Grünke)
- 1926: Schützenliesl
(nach der Operette von Edmund
Eysler (Musik), Leo
Stein und Karl
Lindau (Libretti);
R: Rudolf
Walther-Fein, Rudolf
Dworsky; mit Xenia
Desni als Liesl, Tochter der Mooshammerwirtin (Mizzi
Zwerenz);
Livio
Pavanelli als Forstadjunkt Konrad Sturm; Claire Lotto als Fräulein
Wilhelmine)
→ IMDb;
siehe auch Verfilmung 1954
- 1922: Wer wirft den ersten Stein?
(R: Arthur
Günsburg; als Goot, Direktor der Tabakfabrik)
- 1922: Nathan
der Weise (nach dem gleichnamigen
Drama von Gotthold
Ephraim Lessing; R: Manfred
Noa;
mit Werner
Krauß in der Titelrolle; als der Tempelherr) → filmportal.de,
prisma.de
- 1923: Schlagende
Wetter
(nach einer Vorlage von Stefan Großmann;
R: Karl
Grune; als der Freund des Verführers
George (Walther
Brügmann))→ filmportal.de
- 1923: Das Spiel der Liebe
(R: Guido
Parisch alias Guido Schamberg; mit Marcella Albani;
als Ingenieur Georg)
- 1924: Helena
(nach Motiven der "Ilias"
von Homer;
R: Manfred
Noa; mit Edy Darclea (1895–?) als die schöne Helena,
Wladimir
Gaidarow als Paris; als
trojanischer Held Hektor,
Gatte der Andromache
(Hanna
Ralph))
→ film.at,
Fünf-Seen-Filmfestival
- 1924: Das blonde Hannele
(R: Franz
Seitz sr,; mit Maria
Minzenti in der Titelrolle; als Maler Walter Bergson)
- 1924: …die sich verkaufen
(R: Fritz
Greiner; als ?)
- 1924: Die vier letzten Sekunden des Quidam Uhl
(R: Robert
Reinert; als Quidam Uhl) → IMDb
- 1924/25: Der
erste Stand. Der Großkapitalist (gedreht 1924, Zensur: 09.11.1925;
Arbeitstitel: Rex Mundi / Der tanzende Tod;
R: Rolf
Raffé; mit Eugen
Klöpfer als Großindustrieller Kerkoven; als Lavin)
- 1925: Die
Europameisterschaft (R: Peter Heuser; als ?)
- Teil 2: Der letzte Grenadier
- 1925/27: Filme über Otto
von Bismarck, dargestellt von Franz
Ludwig (als Kaiser Napoleon
III.)
- 1926: Der Wilderer
(R: Johannes
Meyer; als Werner, Jäger des Grafen Oetzbach (Heinrich
Schroth))
→ Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1926: Das Geheimnis von St. Pauli
(R: Rolf
Randolf; als ?)
- 1926: Ich hatt einen Kameraden
(R: Conrad
Wiene; als Oberleutnant Hellmuth von Khaden) → www.dhm.de
- 1926: Das Lebenslied
(nach dem Roman von Rudolf Herzog;
R: Arthur Bergen;
als Richards Marschall)
- 1927: Der Bettler vom Kölner Dom
(R: Rolf Randolf;
als "der Bettler", Anführer der Diebesbande)
- 1927: Stolzenfels am Rhein.
Napoleon in Moskau (R: Richard
Löwenbein; als preußischer Major Wenzel von Geyr;
Egon von Hagen als Napoleon
I., Kaiser von Frankreich)
- 1927: U 9 Weddigen –
Ein Heldenschicksal aus vergangenen Tagen (R: Heinz
Paul; als Otto
Weddigen, unter anderem
U-Boot-Kommandant der "SM
U 9" und der "SM
U 29") → filmportal.de
- 1927: Die Lindenwirtin am Rhein –
Die Geschichte einer jungen Liebe (R: Rolf
Randolf; mit Maly
Delschaft
als die Lindenwirtin; als Dr. Allertag)
- 1927: Gefährdete Mädchen / Was weißt Du von der
Liebe (R:
Heinz Schall; als ?) → IMDb
- 1927: Der Fluch der
Vererbung. Die nicht Mütter werden dürfen –
Ein Film von Liebe und Pflicht (über die so genannte
"Bluterkrankheit";
R: Adolf
Trotz; als Dr. Münchow, Verlobter von Olga Römer (Marcella
Albani))
-
1927: Der fröhliche Weinberg
(nach dem gleichnamigen
Lustspiel von Carl
Zuckmayer; R: Jakob
Fleck, Luise Fleck;
als der mittellose Rheinschiffer Jochen Most,
Bruder von Annemarie
Most (Lotte
Neumann), der Hausdame des
Weingutsbesitzers Jean Baptiste Gunderloch
(Rudolf Rittner))
- 1928: Frau Sorge
(nach dem Roman von Hermann
Sudermann; R: Robert
Land; mit Mary
Carr in der Titelrolle der
Frau Meyhöfer alias "Frau Sorge", Ehefrau von Herrn
Meyhöfer (Fritz
Kortner); als Baron Douglas) → filmportal.de
- 1928: Haus Nummer 17
(nach dem Kriminalstück "Number 17" von Joseph Jefferson Farjeon (1883–1955);
R: Géza
von Bolváry; als Privatdetektiv Gilbert Fordyce (dt.
Fassung: Barton))
- 1928: Herr Meister und Frau Meisterin – Ehret Eure deutschen Meister!
(R: Alfred Theodor Mann; als Robert)
- 1928: Zuflucht
(R: Carl
Froelich; mit Henny
Porten und Franz
Lederer; als Fleischergehilfe Kölling)
→ filmportal.de,
stummfilmkonzerte.de
- 1928: Hinter Klostermauern
(nach dem Bühnenstück von Anton
Ohorn; R: Franz
Seitz sr.; als Bruder Meinrad)
- 1929: Waterloo.
Ein Zeitbild (über die Schlacht
bei Waterloo am 18. Juni 1815; R: Karl
Grune; mit Otto
Gebühr als
Feldmarschall Gebhard
Leberecht von Blücher / Friedrich
der Große; Charles
Vanel als Napoléon
Bonaparte;
als Marschall Michel
Ney) → filmportal.de
- 1929: Die Schleiertänzerin / Le meneur de joies
(R: Charles Burguet (1878–1946); als ?) → Zensurentscheidung
- 1929: Morgenröte. Todesstollen 306 – Ein Spielfilm aus dem Waldenburger Kohlenrevier
(R: Wolfgang
Neff;
als Bernhard Eggebrecht)
- 1929: Andreas
Hofer. Der Freiheitskampf des Tiroler Volkes (R/Drehbuch:
Hanns Prechtl; mit Fritz
Greiner in der Titelrolle
des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas
Hofer; als Adjutant/Major Josef
Eisenstecken) → stummfilm.at
- 1929: Drei Tage auf Leben und
Tod. Aus dem Logbuch der U.C.1 (R: Heinz
Paul; als U-Boot-Kommandan der "SM
UC 1")
- 1929: Schande / Hanba
(Produktion: Tschechoslowakei/Deutschland; R: Josef Medeotti-Bohác (1884–1945); als
Dr. Holan)
Tonfilme
- Produktionen bis 1939
- 1929: Carl de Vogt singt zwei Lieder zur Laute (Kurz-Dokumentarfilm;
R: ?)
- 1930: Lumpenball
(R: Carl
Heinz Wolff; als Rechtsanwalt Dr. Wiegand)
- 1930: Flachsmann als Erzieher
(nach dem Bühnenstück von Otto
Ernst; R: Carl Heinz Wolff; mit Paul
Henckels
als als Oberlehrer/Rektor Jürgen Heinrich Flachsmann; als
Lehrer Bernhard Vogelsang) → projekt-gutenberg.org
- 1931: Die Frau – Die Nachtigall
/ Die Perle des Südens (R: Leo Lasko;
als ein Offizier) → IMDb
- 1931: Das Geheimnis der roten Katze
(R: Erich
Schönfelder; als ?) → filmdienst.de
- 1932: Melodie der Liebe
(R: Georg
Jacoby; mit Tenor Richard
Tauber in der Hauptrolle des Kammersängers
Richard Hoffmann; als der Wirt "Zum schmalen
Handtuch")
→ filmportal.de
(Besetzung)
- 1932: Teilnehmer antwortet nicht
(R: Mark
Sorkin, Rudolf
Katscher; als Kommissär Buhlke)
- 1932: Die elf Schill’schen
Offiziere
(R: Rudolf
Meinert; als Patriot und Freiheitskämpfer Ferdinand
von Schill)
→ filmportal.de
- 1932: Die
Tänzerin von Sanssouci (Fridericus-Rex-Film;
R: Friedrich
Zelnik; mit Otto
Gebühr als Friedrich II.
und Lil
Dagover als
Barberina
Campanini, die Tänzerin von Sanssouci; als Antoine
Pesne, seit 1722 Direktor
der "Berliner
Kunstakademie") → filmportal.de
- 1932: Trenck – Der Roman einer großen Liebe (nach dem Roman "Trenck.
Roman eines Günstlings" von Bruno
Frank;
R: Heinz
Paul, Ernst
Neubach; mit Hans
Stüwe als Friedrich
von der Trenck, Dorothea
Wieck als Kronprinzessin Amalie,
jüngste Schwester des Preußenkönigs Friedrich
II. (Theodor
Loos); als Herzog von Württemberg)
→ filmportal.de
- 1932: Der Tanz im Wandel der Zeit (Kurz-Dokumentarfilm;
R: ?)
- 1933: Das Lied der schwarzen Berge
/ Der Sohn der schwarzen Berge (R: Hans Natge;
als Windolf;
Kurzinfo: Deutsche Abenteurer entdecken die kulturellen und natürlichen Reichtümer der Regionen Jugoslawiens.
Umrahmt wird das Ganze von einer Liebesgeschichte. Zwei Kulturen und
Weltanschauungen treffen aufeinander –
die der der germanischen und der slawischen. ) → IMDb
- 1933: Ein
Lied geht um die Welt
(R: Richard
Oswald; mit Tenor Joseph
Schmidt; als Theaterdirektor) → filmportal.de
- 1933: Die Nacht der großen Liebe
(R: Géza
von Bolváry; als der Kapitän)
- 1933: Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (R: Charles
Klein; als Gutsverwalter Fritz Wendhofer) → IMDb
- 1933: Schüsse an der Grenze (R: Johann
Alexander Hübler-Kahla; als ?) → filmdienst.de,
IMDb
- 1933: Liebesfrühling
(R: Karl Otto Krause;
als ?)
- 1933: Die weiße Majestät
(R: Anton
Kutter, August
Kern; als Bnndesrichter Dr. Reymond)
- 1933: Blut und
Boden. Grundlagen zum Neuen Reich
(Kurzfilm mit Dokumentarteilen über die "Blut-und-Boden-Ideologie"
der Nazis; diverse Regisseure; als ?) → Wikipedia (englisch)
- 1934: Wilhelm
Tell. Das Freiheitsdrama eines Volkes / Guillaume Tell (frei
nach der Chronik von Aegidius
Tschudi,
dem gleichnamigen
Drama von Friedrich
Schiller und der Erzählung "Der Knabe des
Tell" von Jeremias
Gotthelf;
R: Heinz
Paul; mit Hans
Marr als Wilhelm
Tell und Conrad
Veidt als dessen Gegenspieler Reichsvogt Gessler;
als Konrad Baumgarten, Landsmann aus Unterwalden)
- 1934: Zu Straßburg auf der Schanz (R: Franz
Osten; als Konrad, Sohn der Gutsherrin Ida Pfister (Anna
von Palen):
Kurzinfo: Zwei Brüder (Hans
Stüwe/Carl
de Vogt)
der Schweizerischen Eidgenossenschaft verlieben sich in dieselbe
Frau (Ursula
Grabley) und kämpfen für die Freiheit
gegen die Herrschaft der Franzosen.)
→ Wikipedia (englisch),
wunschliste.de)
- 1934: Elisabeth und der Narr
(R: Thea
von Harbou; mit Hertha
Thiele als Elisabeth, Tochter von Bankier
Dietrich (Fritz
Alberti) und Rudolf
Klein-Rogge als der einfach gestrickte Dorfmensch Michele, der
sich in Elisabeth
verliebt hat; als ?) → filmportal.de
- 1934: Ich für Dich – Du für mich
(NS-Propagandafilm für den weiblichen "Reichsarbeitsdienst";
R: Carl
Froelich;
als Siedler Kollerbuch; Kurzinfo: Deutsche Mädchen aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen im
"Bund deutscher
Mädel" (BDN) zusammen, um dem Vaterland zu dienen, indem sie Getreide ernten, Hausarbeit
erledigen, als Hebammen fungieren, beim Basteln helfen und
fröhliche Lieder singen.)
→ IMDb
- 1935: Soldatenlieder
(Kurz-Spielfilm von (Regie) Wilhelm
Prager; als ?)
- 1936: Fährmann
Maria (R: Frank
Wysbar; mit Sybille
Schmitz als Maria; als der Geiger) → filmportal.de
- 1936: Wenn wir alle Engel wären (R:
Carl
Froelich; nach dem Roman von Heinrich
Spoerl; mit Heinz
Rühmann
und Leny
Marenbach; als Hotelportier)
→ filmportal.de
- 1936: Ein Mannsbild muss her
(Kurz-Spielfilm von (Regie) Hans Morschel; als Hansel)
- 1938: Musketier Meier III (R: Joe
Stöckel; mit Rudi
Godden als Meier III; als Unteroffizier Macke) → IMDb
- 1939: Rheinische Brautfahrt
(R: Alois
Johannes Lippl; als Rechtsanwalt Dr. Vollbrecht) → Murnau Stiftung
- Nachkriegsproduktionen (Kinofilme, wenn nicht
anders vermerkt)
|
|

|
Um zur Seite der Publikumslieblinge zurückzukehren, bitte dieses Fenster
schließen.
Home: www.steffi-line.de
|