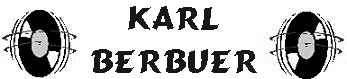Karl Berbuer wurde am 26. Juli 1900 als Sohn eines Bäckers in Köln1)
geboren, besuchte später die Volksschule im Severinsviertel. Sein beruflicher
Weg schien vorgezeichnet, wie seine Brüder machte er eine Lehre als Bäcker.
Mit 17 Jahren musste er während des 1. Weltkrieges als Soldat seine Pflicht
tun, kehrte erst 1919 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und arbeitete im
erlernten Beruf, machte 1929 seine Meisterprüfung. Doch bereits nach seiner
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft interessierte sich Berbuer für die
Schauspielerei und betätigte sich seit 1919 als Darsteller an
der von Wilhelm Schneider-Clauß1) (1862 – 1949) gegründeten Laienbühne, trug auch zu der Zeit schon
selbstverfasste Lieder vor.

|
Ab 1924 engagierte
er sich aktiv im Kölner Karneval1) und wurde schon vor dem 2. Weltkrieg
mit so unvergessenen "Gassenhauern" wie "Heidewitzka,
Herr Kapitän, mem Müllemer Bötche fahre mer su jän"1) (1936) oder "Das kannst Du nicht ahnen" (1938)
weit über die Grenzen Kölns bekannt. Nach dem Krieg sang er sich mit seinen
witzig-distanzierten Liedern mit Themen, die die Menschen in jenen Tagen
bewegten, in die Herzen seines Publikums. 1946 entstand sein
"Kartoffellied" und zuvor hatte er schon mit "Au yes Marie, au yes, janz Germany hätt Schieß"
die Briten verulkt.
1947/48 entstand dann das legendäre Lied "Wir sind die Eingeborenen von
Trizonesien"1).
Das "Müllemer Bötche" auf dem
Kölner "Karl-Berbuer-Platz"
Urheber: Willy Horsch; Lizenz: CC BY 3.0
Quelle: Wikimedia
Commons |
|
Karl Berbuer traf mit seiner musikalischen Parodie auf die
Nachkriegsverhältnisse den Nerv seiner Zuhörer/-innen und heute weiß wohl kaum
noch jemand, was das bedeutete: Trizonesien waren die drei von den westlichen
Alliierten besetzten Zonen ("Trizone"1)), das Lied wurde so erfolgreich, dass es
sogar als Ersatz für die noch fehlende Nationalhymne herhalten musste: 1949 erklang
der "Trizonesien"-Song für den deutschen Sieger des
ersten internationalen Radrennens in Köln nach dem Krieg.
|
Mit selbst gedichteten stimmungsvollen Schunkelliedern wie "Eß dat dann nix, Marie (1938),
"O Mosella" (1947), ", "Un et Arnöldche fleut" (1950)
oder dem Camping-Lied1)
"Do laachs do dich kapott, dat nennt m'r Camping" (1954) bleibt
Berbuer
bis heute unvergessen. Insgesamt dichtete Karl Berbuer rund 120 Lieder und
Couplets, von denen viele bis heute zum Repertoire einschlägiger
Interpreten gehören.
Karl Berbuer starb am 17. November 1977 in seiner Heimatstadt Köln an den
Folgen eines Schlaganfalls, die letzte Ruhe fand er auf dem dortigen
"Südfriedhof"1)
(Flur 83); in der Grabstelle wurde später auch
seine Ehefrau Franziska (geb. Wolfgarten, 1906 – 1992) beigesetzt.
Die Stadt ehrte ihren
berühmten Sohn 1987 mit einem Denkmal, dem einem Narrenschiff
nachempfundenen bronzene "Karl-Berbuer-Brunnen" auf dem "Karl-Berbuer-Platz"
im Severinsviertel, geschaffen von dem
Bildhauer Bonifatius Stirnberg1).
Grabstelle von Karl Berbuer
auf dem Kölner
"Südfriedhof"
© Wilfried Paqué
|

|
|