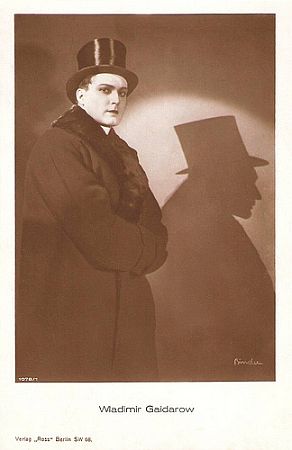 |
Zu seinen vielbeachteten Rollen jener Jahre zählte unter
anderem die Figur des Zaren Nikolaus I.1) in
der Adaption "Otez Sergi"1) (1918, "Vater Sergius")
nach der Kurzgeschichte "Vater Sergej"1)
von Leo Tolstoi1) an der Seite des Stars
bzw. Titelhelden Iwan Mosschuchin (Ivan Mozzhukhin).
Erzählt wird die Geschichte des Prinzen bzw. adeligen
Offiziers Kasatsky (Iwan Mosschuchin), der ins Kloster geht und Mönch wird, nachdem seine Verlobte,
die Gräfin Maria Korotkowa (Wera Dschenejewa),
eine Affäre mit dem Zaren begonnen hat; Regie führten Jakow Protasanow1) – mit ihm arbeitete
er mehrfach zusammen – und Alexander Wolkow1), der zudem für das Drehbuch verantwortlich
zeichnete.
Aufgrund der politischen Wirren bzw. Unruhen nach der russischen Oktoberrevolution1) ging Gaidarow
mit seiner Ehefrau zunächst im November 1920 nach Estland1), wirkte über zwei
Monate am Theater in Reval1)
(heute: Tallinn) und kam dann im März 1921 über Riga1)
(Lettland1)) nach Berlin.
Gemeinsam mit anderen russischen Exil-Künstlern wurde er kurz danach für das
stumme Melodram "Die
Gezeichneten"1) (1922) engagiert, von
Carl Theodor Dreyer1) gedreht nach dem 1912 erschienenen,
komplexen Roman "Elsker hverandre"
des dänischen Schriftstellers Aage Madelung1), mit dem der Autor die
anti-semitischen
Pogrome im vorrevolutionären Russland in den Jahren zwischen 1900 und 1905
thematisiert. Gaidarow überzeugte an der
Seite der Protagonistin Gräfin Polina Piechowska gleich mit der tragenden
Rolle deren zum christlichen Glauben übergetretenen Bruders Jakow Segal
→ filmportal.de.
Wladimir Gaidarow vor 1929
Urheber bzw. Nutzungsrechtinhaber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com
bzw. www.flickr.com;
Ross-Karte Nr. 1978/1
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
|
Wenig später betraute ihn Friedrich Wilhelm Murnau1)
in seinem als verschollen geltenden Meisterwerk "Der
brennende Acker"1) (1922) neben Stars wie
Eugen Klöpfer,
Werner Krauß und
Lya de Putti
mit der zentralen Figur des Johannes Rog, Sohn des alten Bauern Rog (Krauß)
bzw. Bruder von Peter (Klöpfer). Wladimir Gaidarow avancierte in kurzer Zeit in Deutschland zum neuen
Leinwand-Idol, machte in Melodramen, Abenteuern und Kriminalgeschichten als "adonishafter Heroe"*)
und "bleichgesichtiger Betörer"**)
Furore. In dem Abenteuer "Der Mann mit der eisernen Maske"1) (1923)
nach dem Roman von Alexandre Dumas d. .1) zeigte er
sich unter der Regie von Max Glass1) mit der Doppelrolle des französischen
Sonnenkönigs Ludwig XIV.1)
und dessen angeblichen Zwillingsbruders Bertrand, der "Mann mit der
eisernen Maske" – unter anderem glänzte Albert Bassermann
als Kardinal Jules Mazarin1). In
Joe Mays1) vierteiligem,
kriminalistischen Gesellschaftsdrama "Tragödie der Liebe"1) (1923) tauchte er
als André Rabatin auf, der unter Mordverdacht gerät und
am Ende der Geschichte bei einem Handgemenge selbst sein Leben verliert.
Filmpionier Joe May hatte den Streifen, "der in der Vollkommenheit alles
bot, was der damalige Entwicklungsstand des Films erforderte"2),
publikumswirksam besetzt, neben Gaidarow und May-Ehefrau Mia May
(Gräfin Manon Moreau) standen unter anderem Emil Jannings
(der brutale Ringkämpfer Ombrade), Erika Glässner
(dessen Geliebte Musette), Ida Wüst
(Madame de la Roquére) und Rudolf Forster (Graf François Moreau) auf der Besetzungsliste,
Film-Debütantin Marlene Dietrich zeigte sich
als Lucie, Freundin des Staatsanwalts (Curt Goetz) ebenfalls mit einem kleinen Part.
Wladimir Gaidarow zwischen 1915 und 1920
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: Wikimedia
Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
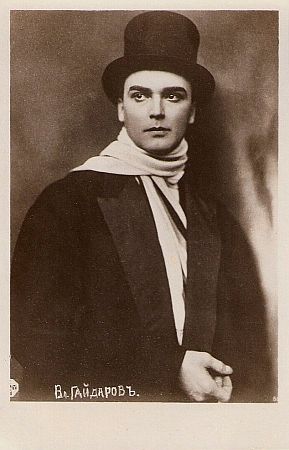 |
Zum großen Erfolg geriet Manfred Noas1)
zweiteiliges, hochkarätig besetztes Troja1)-Epos "Helena"1) (1923/24),
in dem Gaidarow als strahlender Königssohn Paris1) neben
der bis dahin völlig unbekannten italienischen Stummfilm-Darstellerin Edy Darclea (1895 – ?) als die schöne
Helena1)
und Publikumslieblingen wie Carl de Vogt
(Hektor1)),
Friedrich Ulmer
(Menelaos1)),
Albert Steinrück (König
Priamos1))
oder Adele Sandrock
(dessen Gattin Hekabe1))
begeisterte. Der aufwendige Monumentalfilm, basierend auf Motiven der antiken "Ilias"1)-Sage
des Homer1)
sowie einem Drehbuch von Hans Kyser1), erregte auch durch
spektakuläre Massenszenen Aufsehen, ist heute jedoch nicht mehr als Originalfassung erhalten.
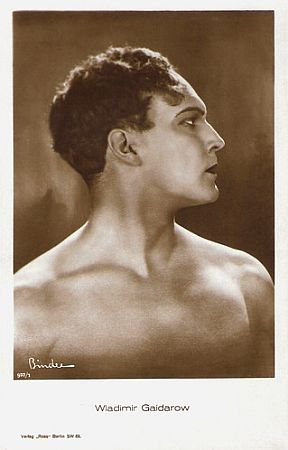 |
Die österreichische Tageszeitung "Neue
Freie Presse"1) notierte in ihrer
Ausgabe vom 7. November 1924 unter anderem: "Dieser Helena-Film
ist eine Großtat. Er ist würdig, auf die feinste Goldwaage der Kritik gelegt
zu werden (…) Wir wollen bloß sagen, daß die dramatische Verdichtung
des epischen Stoffels im allgemeinen recht gut, im ersten, viel freier an die
Ueberlieferung angelehnten Teile besser als im zweiten gelungen ist. Womit man
nicht durchwegs einverstanden sein dürfte ist die Lösung der in solchem
Falle ungemein schwierigen Besetzungsfragen. Der Priamos
Albert Steinrücks ist kaum zu übertreffen. Desgleichen der trojanische
Seher Aisakos1)
Albert Bassermanns.
Auch die niobeske Gestalt der Hekabe ist bei Adele Sandrock in guten
Händen. Für den Paris hätte man gleichfalls schwerlich einen schöneren und
hellenischer wirkenden Darsteller finde können als den so rasch bekannt
gewordenen Wladimir Gaidarow. Aber schon die Helena der ausnehmend
schönen Edy Darclea regt doch ein wenig dazu an, im Gedächtnis Umschau
nach irgendeiner gewiß noch viel zutreffenderen Helena zu suchen. (…)
Dieser Achill1)
des Athleten Carlo Aldini1),
mit Verlaub, so schaut Achill nicht aus. (…) Technisch, photographisch,
regiemäßig steht dieser Film auf kaum zu überbietendem Niveau. Wunderbar
die Visionstechnik im ersten Teil, zumal in dem zum Traume umgedeuteten Urteil
des Paris." → anno.onb.ac.at
Wladimir Gaidarow ca. 1925/26
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929);
Ross-Karte Nr. 977/1
Quelle:
filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
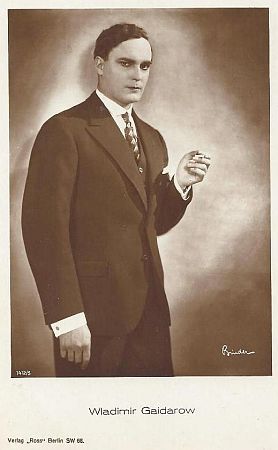 |
"Dornenweg einer
Fürstin"1) (1928) hieß das Melodram mit Suzanne Delmas (1901–1984) als Fürstin Ludmilla Woronzowa,
Gaidarow als Student bzw. Exil-Russe Alexander Kolossow und Grigori Chmara1)
als skandalumwitterter, russischer Wanderprediger und Wunderheiler Grigori Rasputin1). Für
Gennaro
Righelli1) mimte er in dem Abenteuer
"Frauenraub
in Marokko"1) (1928) den
Afrikaforscher Fred Morton, der in der Maske des finsteren Arabers Ben Rawak
die verwöhnte und exaltierte amerikanische Dollar-Millionärin Elinor
Clifford (Claire
Rommer) beeindrucken soll. Als dann der reale, schurkische Rawak (Aruth
Wartan1)) auftaucht, kann sich Fred als
heldenhafter Retter beweisen und schließlich das Herz der anspruchsvollen
Amerikanerin gewinnen. Die Wiener Zeitug "Der Tag"1) (01.03.1929, S. 8) meinte unter
anderem: "Wladimir Gaidarow bewegt sich als Wüstensohn wie
aus dem Lexikon geschnitten: schön, edel, romantisch. Und seine
darstellerischen Qualitäten beweisen sich als gediegene. Claire Rommer ist
eine sehr hübsche Amerikanerin … Der Film im ganzen ist an Abwechslung
reich und mit Spannungsstoff bis an den Rand gefüllt." → anno.onb.ac.at
Letzte Arbeit für den Stummfilm war das romantische Ostsee-Abenteuer
um Alkoholschmuggel und Liebe mit dem Titel "Wellen
der Leidenschaft"1) (1930,
auch "Kurs auf die Ehe"/"Kire lained") und seiner Rolle
des Schriftstellers bzw. Journalisten Rex. Mit
dieser deutsch-estnischen Co-Produktion, in der Raimondo van Riel,
Ita Rina und Fritz Greiner zur Besetzung gehörten, lieferte der
Schauspieler mit seiner "Wladimir Gaidarow-Film GmbH" zugleich
sein Regie-Debüt ab → Übersicht Stummfilme.
Wladimir Gaidarow ca. 1927/28
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929);
Ross-Karte Nr. 1412/5
Quelle: Wikimedia
Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
Der Übergang zum Tonfilm gestaltete sich für Gaiderow wegen
mangelnder Sprachkenntnisse in Deutschland problematisch. Er drehte lediglich
noch zwei Filme, trat in Carl Froelichs1),
zur Zeit der
napoleonischen Kriege1) angesiedelten
Historiendrama bzw. Biopic "Luise,
Königin von Preußen"1) (1931) neben
Stummfilmstar Henny Porten
(Königin
Luise1)) als russischer Zar Alexander I.1),
Verbündeter des preußischen Königs bzw. Luises Gemahl Friedrich Wilhelm III.1) (Gustaf Gründgens),
in Erscheinung, beendete dann seine Karriere in Deutschland mit der Hauptrolle
des Violinvirtuosen Mario Orbeliani in James Bauers1) psychologischen
Kriminalfilm "Nachtkolonne" (1932) als Partner bzw.
Film-Ehemann von Olga Tschechowa.
Mit der so genannten Machtergreifung1) der Nationalsozialisten ging Gaidarow 1933 mit seiner
Ehefrau Olga Gsowskaja zurück in die Sowjetunion1) und ließ sich ein Jahr später in Leningrad
(heute: Sankt Petersburg1)) nieder. Hier konzentrierte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder auf seine Arbeit am Theater,
gehörte ab 1938 drei Jahrzehnte lang zum Ensemble des "Puschkin-Theaters"
(heute: "Alexandrinski-Theater"1));
darüber hinaus hielt er mit seiner Frau Lesungen ab und veranstaltete literarische Vorträge.
Nur noch sporadisch ließ er sich vor die Kamera locken, erwähnenswert ist
seine Verkörperung des Generalfeldmarschalls Friedrich Paulus1) in Vladimir Petrovs
(1896 – 1966) zweiteiligem, monumentalen propagandistischen Kriegsdrama "Die Stalingrader Schlacht" (1949,
"Stalingradskaja bitwa") über die Schlacht
von Stalingrad1) mit Aleksei Dikiy (1889 – 1955) als
sowjetischer Diktator Josef Stalin1), für die er 1950 mit dem "Stalinpreis"1)
ausgezeichnet wurde. Den Generalfeldmarschall Paulus hatte er bereits in dem
Biopic "Der Schwur"4) (1946, "Klyatva") dargestellt,
inszeniert von Micheil Tschiaureli1)
mit Michail Gelowani1) als Stalin
und Höhepunkt des filmischen Personenkultes um den kommunistischen Machthaber
→ Übersicht Tonfilme.
Der einstige Stummfilmstar und 1940 als "Volkskünstler der RSFSR"1)
geehrte Schauspieler Wladimir Gaidarow starb am 17. Dezember 1976
im Alter von 83 Jahren in Leningrad (Sowjetunion). Rund zehn Jahre zuvor hatte
er seine Memoiren veröffentlicht.
Seine Ehefrau Olga Wladimirowna Gsowskaja1) war bereits am 2. Juni 1962
78-jährig ebenfalls in Leningrad gestorben.
|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database,
filmportal.de
(Fremde Links: Wikipedia)
|
Stummfilme
- In Russland (Auszug)
- In Deutschland (wenn nicht anders vermerkt)
- 1922: Die
Gezeichneten (nach dem Roman "Elsker hverandre" von Aage
Madelung; R/Drehbuch: Carl
Theodor Dreyer;
als Jakow Segal, Bruder von Hanne-Liebe (Polina Piechowska)) → filmportal.de
- 1922: Der
brennende Acker (R: Friedrich
Wilhelm Murnau; als Johannes, Sohn des alten Bauern Rog (Werner
Krauß),
Bruder von Peter (Eugen
Klöpfer)) → Murnau
Stiftung, filmportal.de
- 1923: Tragödie der Liebe
(R: Joe
May; mit dessen Ehefrau Mia
May als Gräfin Manon Moreau sowie
Emil Jannings
als der brutale Ringkämpfer Ombrade in den Hauptrollen; als André
Rabatin, Geliebter von Manon)
→ filmportal.de,
marlenedietrich-filme.de
- 1923: Der Mann mit der eisernen Maske
(nach dem Roman von Alexandre
Dumas d.Ä.; R: Max
Glass;
als Ludwig XIV. sowie dessen Zwillingsbruder Bertrand, der "Mann mit der eisernen
Maske")
- 1924: Helena
(nach Motiven der "Ilias"
des Homer;
R: Manfred Noa; mit Edy Darclea (1895–?) als die
schöne
Helena; als Paris)
→ film.at,
Fünf-Seen-Filmfestival
- 1924: Liebet das Leben
(R:
Georg Asagaroff; mit Olga
Gsowskaja; als ?) → IMDb
- 1925: Hochstapler wider Willen
(R: Géza von Bolváry; in
einer Doppelrolle; mit Olga Gsowskaja) → IMDb
- 1925: Die Frau von vierzig Jahren (R: Richard
Oswald; mit Diana Karenne
als die Frau; als Er) → IMDb
- 1925: La ronde de nuit (Produktion: Frankreich; R: Marcel Silver (1891–?); als Prinz Laszlo) → IMDb
- 1926: Manon Lescaut
(nach dem Roman "Histoire
de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux" von
Antoine-François Prévost;
R: Arthur
Robison; mit Lya
de Putti als Manon Lescaut; als Chevalier des Grieux)
→ filmportal.de,
marlenedietrich-filme.de
- 1926: Die Flucht in den Zirkus / Verurteilt nach Sibirien – Moskau 1912
(R: Mario
Bonnard, Guido Schamberg
(d. i. Guido
Parisch/Parish); mit Marcella
Albani als Revolutionärin Vera; als Offizier Graf Wladimir
Bobrikoff)
- 1926: Kampf der Geschlechter.
Die Frauen von heute in der Ehe von gestern (R: Heinrich
Brandt; als ?) → IMDb
- 1927: Mitgiftjäger / Le roman d'un jeune homme pauvre (Produktion:
Frankreich; nach der Komödie
"Le roman d'un jeune homme pauvre" von Octave
Feuillet; R: Gaston
Ravel; als Maxime Odiot) → IMDb
- 1927: Die weiße Sklavin
(R: Augusto
Genina; als Ali Enver Bey, Liane
Haid als Lady Mary Watson)
- 1927: Alpenglühen (R: Hanns Beck-Gaden;
als ?) → IMDb
- 1927: Alpentragödie
(nach "Alpentragödie. Roman aus dem Engadin" von Richard
Voß; R: Robert
Land;
als Maler Sivo Courtien, Lucy
Doraine als Gräfin Josette da Rimini)
- 1928: Die Dame mit der Maske
(R: Wilhelm
Thiele; mit Arlette
Marchal in der Titelrolle der verarmten, jungen
Adeligen Doris von Seefeld; als der Exil-Russe Alexander von Illagin)
→ filmportal.de,
Murnau Stiftung
- 1928: Die Frau auf der Folter
(nach dem Theaterstück von Edward Hemmerde (1871–1948) und
Francis Neilson (1867–1961); R: Robert
Wiene; mit Lily
Damita; als ?) → Wikipedia (englisch)
- 1928: Dornenweg einer Fürstin
(R: Nikolai Larin (1888–1944); als Student bzw. Exil-Russe Alexander Kolossow;
Suzanne Delmas (1901–1984) als Fürstin Ludmilla Woronzowa; u. a.
Grigori Chmara
als skandalumwitterter,
russischer Wanderprediger und Wunderheiler Grigori Rasputin)
- 1928: Frauenraub in Marokko
(R: Gennaro
Righelli; als Fred Morton, Claire
Rommer als amerikanische
Dollar-Millionärin Elinor Clifford)
- 1929: Heilige oder Dirne /
Nebenbuhlerinnen / Madonna oder Dirne (nach dem Bühnenstück von Georges
Ohnet;
R: Martin
Berger; mit Maria
Corda als die die triebhafte Lydia; als ?) → IMDb
- 1930: Wellen
der Leidenschaft / Kurs auf die Ehe / Kire lained (Produktion
Estland/Deutschland;
als Schriftsteller und Journalist Rex; auch Regie/Produktion)
Tonfilme
- In Deutschland
- In der Sowjetunion (wenn nicht anders vermerkt)
- 1933: Charlemagne (Produktion Frasnkreich nach der Vorlage
"The Admirable Crichton" von J. M. Barrie;
R: Pierre Colombier (1896–1958); mit Raimu in der Titelrolle; als ?) → IMDb
- 1934: Stepovi pisni (R: Jakow Urinow (1898–1976); als Danila Rogoznyy; mit Olga
Gsowskaja) → IMDb
- 1946: Der Schwur / Klyatva (R: Micheil
Tschiaureli; mit Michail
Gelowani als sowjetischer Diktator Josef
Stalin;
als Generalfeldmarschall Friedrich
Paulus) → filmdienst.de,
Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1949: Die Stalingrader Schlacht / Stalingradskaja bitwa (2 Teile über die Schlacht
von Stalingrad;
R: Wladimir Petrow (1896–1966): mit Aleksei Dikiy (1889–1955) als Josef Stalin; als Generalfeldmarschall
Friedrich Paulus) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1955: Geroi Shipki (Co-Produktion Bulgarien/Sowjetunion über die
Schlacht am
Schipkapass während des
des Russisch-Osmanischen
Krieges 1877/78 und die Rolle der bulgarischen Freiwilligen-Corps;
R: Sergei Wassiljew (1900–1959); als Lord Soulberry)
→ IMDb
- 1968: Bare et liv – historien om Fridtjof Nansen (Co-Produktion
Norwegen/Sowjetunion; R: Sergei Mikaelyan (1923–2016);
mit Knut Wigert als
der berühmte Norweger Fridtjof
Nansen; als ?) → IMDb
- 1969: Oshibka Onore de Balzaka (R: Timofei Lewtschuk (1912–1998); mit
Viktor Chochrjakow (1913–1986) als der
französische Schriftsteller Honoré de Balzac; als General
Bibikov)
→ IMDb
|
|

