Seit 1914 bei der von Alexander Chanschonkow
gegründeten Filmgesellschaft "Chanschonkow & Co" unter
Vertrag, stand er meist für Regisseur Jewgeni Bauer vor der Kamera und
spielte Hauptrollen in Streifen wie "Das Leben im Tod" (1914,
"Zizn' v smerti"): Es ist die
phantastische Geschichte einer Amour fou in der Tradition der obsessiven Helden
Edgar Allen Poes1). Dr. René
(Mosschuchin) tötet seine über alles geliebte Frau, um ihre berückende Schönheit für immer zu bewahren.
Ihren einbalsamierten Leichnam bewahrt er in einer Krypta auf. In dieser Rolle des
bis zum Wahnsinn Liebenden fließen zum ersten Mal die berühmt gewordenen
"Mosjukinschen Tränen". Dieses Ausdrucksmittel kultiviert der in den folgenden Jahren zum größten
russischen Stummfilmstar avancierende Akteur und wird es immer wieder virtuos einsetzen. Er verkörpert damit
ein Männerbild, zu dessen stattlicher und eleganter Virilität sich emotionale Tiefe und Weichheit gesellen.*)
Aus der Vielzahl seiner beachtlichen Darstellungen jener Jahre ist unter der
Regie von Jakow Protasanow der deutsche Offizier und besessene Spieler Herman
in "Pique Dame" (1916, "Pikowaja dama") nach der gleichnamigen
Erzählung1) von Alexander
Puschkin1) zu nennen sowie die Titelfigur in der
Verfilmung
"Pater Sergius"1) (1918,
"Otez Sergei") nach der Novelle "Vater Sergej"1)
von Leo Tolstoi1).
Erzählt wird die Geschichte des Prinzen bzw. adeligen
Offiziers Stepan Kassatski (Iwan Mosschuchin), der ins Kloster geht und Mönch wird, nachdem seine Verlobte,
die Gräfin Maria Korotkowa (Wera Dschenejewa),
eine Affäre mit Zar Nikolaus I.1) (Wladimir Gaidarow) begonnen hat.
"Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jakow Protasanow wird die produktivste seines Lebens."
notiert difarchiv.deutsches-filminstitut.de
und führt weiter aus: "Unter Protasanow spezialisiert er sich auf jene nervösen und dämonischen Charaktere, jene Figuren mit
heimlichen Leidenschaften und dem Hang zum pathologischen Wahn, die, hin und her gerissen zwischen Pflichterfüllung
und Emotion, für das vorrevolutionäre russische Kino so charakteristisch sind. (…) Die romantischen,
nicht selten vom Teufel besessenen oder verführten Figuren in den
Literaturadaptionen dieser Jahre begründen Mosschuchins Image als ambivalenter Typus. Erzählungen
und Romane Puschkins, Tolstojs und Dostojewskis bestimmen dieses literarisch nobilitierte
Kino."
In seinem Buch "Wie ich Nikolai Stavrogin spielte", das kurz nach dem gleichnamigen,
von Protasanow nach dem Roman "Die
Dämonen"1) von Fjodor Dostojewski1)
inszenierten Film veröffentlicht wurde, beschreibt
Mosschuchin 1915 seine schauspielerische Arbeit:
"Die slawische Seele neigt zum Mystischen und zu unkontrollierten Temperamentsausbrüchen
und stimmt darin immer neu ihr Lied von Hoffnung und Verzweiflung an. Solche komplizierten Dramen der Neurasthenie, die jäh
in Grausamkeit umschlagen können, so schwer von unterdrückter Leidenschaft und mystisch, eignen sich ideal für eine ins
Sadistische spielende Sensibilität."*)

|
Wegen der politischen Wirren bzw. Unruhen nach der russischen
Oktoberrevolution1) verließ Mosschuchin wie viele seiner Künstlerkollegen/-kolleginnen
Sowjetrussland1),
emigrierte über Jalta1) (1918) und Konstantinopel
(heute: Istanbul1),
Türkei) Ende 1919
nach Frankreich und lebte zunächst in Marseille1), dann in
der Hauptstadt Paris1).
Dort konnte er als
Filmschauspieler auch durch seinen "für die Großaufnahmen so charakteristischen, durchdringenden
oder abgründigen Blick"*)
an seinen Star-Ruhm anknüpfen und nannte sich nun "Ivan Mosjoukine". Mit ganz auf den Protagonisten Mosschuchin
zugeschnittenen Produktionen entstanden Kassenschlager wie die von
Alexander Wolkow1) gedrehte Biografie
"Verlöschende Fackel" (1922, "Kean ou Disordre et Genie") nach dem Bühnenstück von
Alexandre Dumas d. Ä.1) über den gefeierten Shakespeare-Darsteller Edmund Kean1) (1787 – 1833).
"Die streng frontal fotografierte Sterbeszene am Ende indes ist Iwan Mosschuchins Meisterstück:
In unerhörter Langsamkeit und winzigen Bewegungen nimmt ein Gesicht Abschied von der Welt,
und der Film bietet das ganze Arsenal von Vorhang, Rahmung und Kreisblende auf, um zum Ende zu kommen.
Film wird zur Gruft, die Blende schließt unerbittlicher als jeder Vorhang. Keans Tod
ist wiederum nur ein letzter Auftritt und alles Theater – ein Schluß, den Greenaway hätte diktieren können."*)
Mit der in Deutschland 1924 mit Jugendverbot belegten melodramatischen
Produktion "Ehegeschichten"1) (1923,
"Le brasier ardent")
lieferte Mosschuchin seine einzige Regie-Arbeit (zusammen mit Alexander Wolkow) ab und mimte einen
Detektiv, der nur als "Z" bekannt war und von einem ältlichen
Ehemann (Nicolas Koline1)) angeheuert wird, um die amourösen Abenteuer seiner
schönen jungen Frau (Nathalie Lissenko1)) aufzudecken.
Iwan Mosschuchin auf einer Fotografie des russisch-amerikanischen
Kameramanns
und Fotografen Jack Freulich (1880 – 1936; → IMDb)
Ross-Karte Nr. 3779/1 (ca. 1928/29)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
| Nach Hauptrollen in Wolkows Tragikomödie "Schatten, die vorüberziehen" (1924,
"Les ombres qui passent""),
Jean Epsteins1) romantischem, im Orient angesiedelten Abenteuer "Le lion des Mogols" (1924)
sowie in "Die zwei Leben des Mathias Pascal"1) (1926,
"Feu Mathias Pascal"), in Szene gesetzt
von dem für seine avantgardistischen Filme bekannt gewordenen Marcel L'Herbier1)
nach dem Roman "Il fu Mattia Pascal" von Luigi Pirandello1), machte Mosschuchin als
"Michel Strogoff – Der Kurier des Zaren" (1926,
"Michel Strogoff") Furore und gab in dieser von Viktor Tourjansky1) nach
dem Roman "Der
Kurier des Zaren"1)
("Michael Strogoff") von Jules Verne1) realisierten, frühen
Adaption an der Seite von Nathalie Kovanko1) als der jungen
Nadia Fedor einen eindrucksvoll-charismatischen Titelhelden. Der Streifen war 168 Minuten
lang und somit für
Stummfilme eine ungewöhnliche Inszenierung. Die Außenaufnahmen des Films wurden mit einem
riesigen Aufwand in
Lettland1) gedreht. Zu den Massenszenen wurden 4.000 Soldaten und Kavalleristen der lettischen
Armee hinzugezogen, die als Tataren oder Russen die Schlachtszenen, die
Reiterangriffe oder die Belagerungsszenen gestalteten.
Als Sibirische Steppe mussten die flächigen Weiten vor Riga1)
herhalten und die typischen russischen Holzbauten waren in Lettland
als an vielen Stellen ebenfalls vorhanden. Dadurch erhielt der Film eine
durchgehende Authentizität in der bildhaften Umsetzung der szenisch notwendigen Umgebung.
(Quelle: www.j-verne.de mit weiteren Infos zu dem Film)
Iwan Mosschuchin auf einer Fotografie des russisch-amerikanischen
Kameramanns
und Fotografen Jack Freulich (1880 – 1936; → IMDb)
Ross-Karte Nr. 1265/1 (ca. 1927/28)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
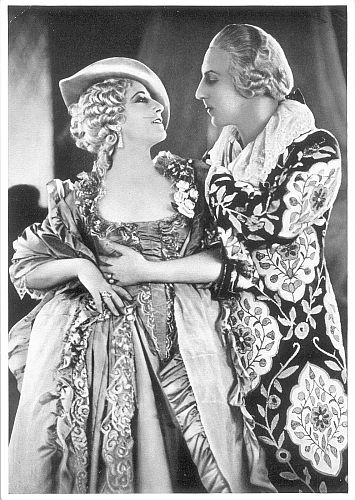 |
Wenig später folgte eine Rolle, die der Russe ebenfalls überzeugend bzw. mit
humorvoller Leichtigkeit zu gestalten wusste: In Alexander Wolkoffs
epischen Biografie
"Casanova"1) (1927) schlüpfte Mosschuchin in das Kostüm des
legendären, venezianischen Frauenhelden Giacomo Casanova1) und spielte an der
Seite von Stars wie der Französin Suzanne Bianchetti1)
(Zarin Katharina die
Große1)), der Kosmopolitin Diana Karenne
(Maria, Herzogin von Lardi) oder der Österreicherin Jenny Jugo
(Thérèse). "Die Rolle des Casanova war maßgeschneidert für Ivan Mosjoukine (…) Er spielt
Casanova als einen Abenteurer à la Douglas Fairbanks, nur mit mehr Esprit,
Ironie und kühler erotischer Ausstrahlung." notiert der
Literaturwissenschaftler Richard Abel in
"French Cinema: The First Wave 1915–1929". Auf dem Höhepunkt seiner schauspielerischen Karriere wagte Mosschuchin – von vielen
als russischer Rudolph Valentino gehandelt – einen Ausflug nach
Hollywood1) und drehte dort mit Regisseur Edward Sloman
(1886 – 1972) bzw. Mary Philbin1) als Partnerin das Kriegs-Melodram "Hingabe" (1927,
"Surrender") nach dem Bühnenstück "Lea Lyon" von Sándor Bródy1), welches
jedoch an den Kinokassen nicht sehr erfolgreich war. Enttäuscht kehrte er nach Europa zurück
und konnte stattdessen in deutschen Stummfilm-Produktionen bei der Berliner
"Greenbaum-Film GmbH" von Jules Greenbaum1) Erfolge feiern.
Szene mit Rina de Liguoro1) als
die Corticelli und Iwan Mosschuchin
als Giacomo
Casanova1)
in dem Stummfilm "Casanova"1) (1927),
inszeniert von Alexander Wolkoff1)
Quelle: Deutsche Fotothek, (file: df_pos-2010-a_0000130)
aus
"Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film" von
Dr. Oskar Kalbus1)
(Berlin 1935, S. 62) bzw. Ross-Verlag 1927
© SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf
Quelle: www.deutschefotothek.de;
Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017
|
Nach der Polit-Satire "Der Präsident"1) (1928),
gedreht von Gennaro Righelli1) nach dem Roman "Der Präsident
von Costa Nuova" von Ludwig von Wohl1),
mit Mosschuchin als der faule Bauer Pepe Torre und unter anderem Suzy Vernon
als Manuela de Valdez, knüpfte er an sein Strogoff-Image an und
stand erneut für Righelli bzw. das nach dem Roman "Rot
und Schwarz"1) von Stendhal1)
entstandene Gesellschaftsdrama "Der geheime Kurier"1) (1928)
vor der Kamera und mimte als Julien Sorel den zeitweiligen Geliebten der Bürgermeisters-Gattin
Madame Thérèse de Rénal (Lil Dagover), die, von ihm
verlassen, Rache nimmt. Ebenfalls 1928 gelangte Wladimir Strijewskis1)
nicht minder dramatische Geschichte "Der Adjutant des Zaren"1) in
die Lichtspielhäuser, mit Carmen Boni
und Mosschuchin in den Hauptrollen eines adeligen, ungleichen Liebespaares. In seinem
vorletzten
Stummfilm "Manolescu"1) (1929) lief Mosschuchin
unter der Regie von Viktor Tourjansky1) noch einmal zur Hochform auf
und glänzte als der rumänische Spieler, Abenteurer und Meisterdieb Georges Manolescu1)
bzw. "König der Hochstapler" neben Brigitte Helm
(die verführerische, skrupellose Cleo), Heinrich George
(deren ruppiger Liebhaber Jack) und Dita Parlo
(Krankenschwester Jeanette).
Sein nächster Film mit der Rolle des Heerführers und Freiheitskämpfers
Hadschi Murat1) in dem Abenteuer "Der weiße Teufel"1) (1930),
inszeniert von Alexander Wolkoff1) nach
der Novelle "Hadschi Murat"1) von
Leo Tolstoi1), wurde bereits mit Tonsequenzen
(z. B. Gewehr- und Kanonenschüsse, Musikeinlagen (Gesang) des Donkosakenchors1))
und einigen Sprachfetzen versehen blieb jedoch über weite Strecken stumm.
Die Resonanz war äußerst positiv, so schrieb die "Lichtbild-Bühne"1)
(Nr. 26, 30.01.1930) unter anderem: "Eine Bombenrolle für Iwan Mosjukin.
Ihm sitzt die Tscherkessen-Uniform unbeschreiblich am straffen Körper, und es
ist ein vollendeter Genuß, wenn er sich auf seinem Schimmel reckt. Ein
Volksheld, wie er im Buche steht. Er hat die Konturen! Im Spiel sind seinen
Mitteln gewiß Grenzen gezogen: aber ein besserer, ein überzeugenderer
Hadschi Murat wird in der Welt nicht zu finden sein. (…) Alexander Wolkoff
hat – eine großartige Regiearbeit bewältigt." In Wiens "Neue Freie Presse"1) urteilte Fritz Frankl zwei Tage nach
der Wiener Premiere in der Ausgabe vom 5. Februar 1930:
"An Mosjukins starke Leistung, nicht nur im Darstellerischen, sondern
auch in der Reitkunst, reiht sich würdig die von Fritz Alberti an, der
Zar Nikolai I.1) weniger als harten Despoten sondern
mehr als Lüstling mit charakteristischen Zügen ausstattet. Die schöne Lil Dagover spielt
eine verführerische Hofdame, Betty Amann1) zeigt sehr graziös sowohl den
Fackel- und Schwertertanz wie auch die Fußspitzentechnik der Petersburger
Ballettschule. Größtes Lob verdienen neben dem Regisseur Wolkoff die Kameramänner
Kurt Courant1)
und Nikolai Toporkoff1), die stimmungsvolle
Landschaften und herrliche Interieurs geschaffen haben, die allein schon den
Film sehenswert machen. Von den Tonuntermalungen sind am schönsten die Lieder
der Donkosaken, deren tiefe Bässe und auffallend hohe Tenorstimmen tadellos
zur Geltung kommen." Und Karlheinz Wendtland meint in seinem Werk "Geliebter
Kintopp"3) der Filme "lebe" im übrigen "von der ungebrochenen
Schauspielkunst Mosjukins". → Übersicht Stummfilme
(Auszug)
Mit Beginn der Tonfilm-Ära zeigten sich für
den Schauspieler erste Sprachprobleme, da sein starker russischer Akzent beim Publikum
kaum Akzeptanz fand. Die Einführung des Tonfilms läßt den Stern des
exilrussischen Schauspielers sinken, der Körperschauspieler Mosjukin kann seine Form der Präsenz nicht mehr ausagieren,
sein Akzent schränkt die Besetzungsmöglichkeiten ein, erlaubt ihm nur Rollen anzunehmen,
in denen das Exotische seiner Sprache eine Bedeutung hat. Zugleich ebbt das Publikumsinteresse am
"Russenfilm" ab, Fremdheit und Exotik werden im Zeichen der
Re-Nationalisierung des Kinos zu Eigenschaften von Nebenfiguren. Und Mosjukin ist keine Figur für den
Bildrand. Sein markantes Profil paßt auch nicht zur Fotogenität, wie sie Hollywood in den dreißiger
Jahren verlangt. Der als französisch-deutsche Koproduktion in zwei Sprachfassungen gedrehte Legionärsfilm "Le Sergeant X"(1931, Regie:
Vladimir Strijewskij1))
deutet mit seinem engen dramaturgischen Schema vom verzichtenden Helden, dessen neue Ordnung der
formierte Männerbund wird, den Rückzug eines Stars an – eine ungewöhnliche Position für den Darsteller
des strahlenden Casanova, der er noch vier Jahre vorher war.*)
Bis zu seinem frühen Tod wirkte Mosschuchin noch in einigen Tonfilm-Remakes seiner großen französischen Erfolge
mit, letztmalig trat er mit der Nebenrolle eines Offiziers in Jacques de Baroncellis1)
Melodram "Nitschewo" (1936, "Nitchevo") neben den
Hauptakteuren Harry Baur1),
Marcelle Chantal1) und
George Rigaud1)
auf der Leinwand in Erscheinung → Übersicht Tonfilme.
Der einst so strahlende Stummfilmstar
Iwan Mosschuchin, ein Virtuose der Stummfilmkunst und
einer der markantesten und nuanciertesten Schauspieler des europäischen Kinos*),
starb völlig verarmt am 18. Januar 1939
im Alter von nur 49 Jahren in einem Krankenhaus im französischen Neuilly-sur-Seine1)
an den Folgen einer Tuberkulose-Erkrankung. Die letzte Ruhe fand er auf dem
"Russischen Friedhof"1)
("Cimetière russe") im Pariser Vorort Sainte-Geneviève-des-Bois1); auf
dem dortigen Grabstein wird als Geburtsdatum allerdings der 26. September 1887
(Julianische
Kalender1)), als Sterbetag der 17. Januar angegeben → Foto
der Grabstelle bei Wikimedia Commons
sowie knerger.de.
Mosschuchin, dem man zahlreiche Liebesaffären nachgesagte, war in erster Ehe mit
der ebenfalls aus Russland emigrierten, populären
Stummfilm-Darstellerin Nathalie Lissenko1)
(auch: Natalya Lyssenko; 1886 – 1969) verheiratet, mit der er mehrfach (unter anderem bereits 1918 in "Otez Sergei")
vor der Kamera stand. Seine
zweite Ehefrau war die dänische Schauspielerin Agnes Petersen1) (Agnes Petersen-Mozzuchinowa; 1904 – 1973)
→ Foto bei cyranos.ch.
Der Mime "bezeichnete sich gerne als von Tscherkessen1) abstammend, was
sich nicht erhärten lässt. Der litauisch-französische Erfolgsschriftsteller der 1960/70er Jahre
Romain Gary1) bezeichnete
Mosschuchin zeitlebens als seinen Vater, was auf jeden Fall fabuliert ist, wie das meiste, was Gary
zu seiner Vita zum besten gab."3)
|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database
sowie filmportal.de
(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de; R = Regie)
|
Stummfilme (Auszug)
- Produktionen in Russland
- 1911: Die Verteidigung von Sewastopol / Oborona Sevastopolya (über die Belagerung
von Sewastopol
während des Krimkrieges
1854 bis 1855; R: Alexander
Chanschonkow, Vasily Goncharov (1861–1915);
als Vizeadmiral Wladimir
Alexejewitsch Kornilow)
→ Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1911: Die Kreuzersonate / Kreytserova sonata (nach der gleichnamigen
Novelle von Leo Tolstoi;
R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin (auch Darsteller); als Geiger Gregor
Tuchatschewsky) → IMDb
- 1913: Die Brüder / Bratya Razboiniki (R: Vasily Goncharov (1861–1915);
als einer der Brüder;
Kurzinfo: Eine Gruppe von Banditen treibt ihr Unwesen an den Ufern der Wolga. Einer von ihnen erzählt
die Geschichte von sich und seinem Bruder.) → IMDb
- 1913: Grausame Rache / Strashnaya mest (nach der Erzählung
"Furchtbare
Rache" von Nikolai Gogol;
R: Władysław
Starewicz; als ?) → IMDb
- 1913: Das Haus in Kolomna / Domik v Kolomne (nach der Verserzählung "Das Häuschen in Kolomna"
von Alexander
Pushkin; R: Pjotr
Iwanowitsch Tschardynin; als der Garde-Offizier; Kurzinfo: Die hübsche junge
Parascha (Sofya Goslavskaya; 1890–1979) lebt bei ihrer verwitweten Mutter (Praskovya Maksimova). Parascha
erledigt fleißig viele Aufgaben im Haushalt, aber sie flirtet auch gerne mit den Wachleuten, die an ihrem Fenster
vorbeigehen, und sie hat einen besonderen Favoriten. Eines Tages bittet Paraschas Mutter sie, einen Koch
zu engagieren, und zwar so günstig wie möglich. Parasha und ihr Freund sehen bald einen Weg, diese Situation
zu ihrem Vorteil zu nutzen.)→ IMDb
- 1913: Noch pered Rozhdestvom (nach der Erzählung "Die
Nacht vor Weihnachten" von Nikolai
Gogol;
R: Władysław
Starewicz; als der Teufel) → Wikipedia (englisch)
- 1913: Sarahs
Lied / Gore Sarri (Kurz-Spielfilm; R: Aleksander Arkatov (1890–1961); als Isaak)
- 1913: Onkels Appartement / Djadjushkina Kvartira (Kurz-Spielfilm;
R: Jewgeni
Franzewitsch Bauer,
Pjotr
Iwanowitsch Tschardynin; als Coco; Kurzinfo: Der Film erzählt von einem Mann namens Coco, der
beschließt, die Wohnung seines Onkels zu vermieten, wodurch sich herausstellt, dass in
dieser Wohnung
bereits völlig unterschiedliche Menschen leben.)→ IMDb
- 1914: Die Frau von Morgen / Zhenshchina zavtrashevo dnya (R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin; als Nikolay,
Verlobter der erfolgreichen Frauenärztin Nora Betskay (Vera Jureneva); Kurzinfo:
"Die Frau von morgen" mit
der großartigen Vera Jureneva (1876–1962) ist eine erfolgreiche und engagierte Frauenärztin, die auch nach Wien
zu einem feministischen Kongress reist und dort einen Vortrag über die Gleichberechtigung der Frau hält.
"Der Triumphtag der Frau wird hoffentlich schon bald kommen, Frauen und Männer sollten gleiche Rechte
haben, weil sie gleicherweise Menschen sind". Im Wartezimmer weist sie sich vordrängelnde Bürgerinnen
in ihre Schranken. Ihr Verlobter fühlt sich vernachlässigt und beginnt ein Verhältnis mit einer Kellnerin.
Ein Kind wird geboren und die Ärztin Nora entdeckt am Bett der schwerkranken Wöchnerin die Wahrheit
und rettet die Kindsmutter.
(Quelle: www.dhm.de)
→ IMDb
- 1914: Nach dem Tode / Zhizn v smerti (R: Jewgeni
Bauer; als Dr. René) → IMDb
- 1914: Chrysanthemen / Krizantemy (R: Pjotr Iwanowitsch
Tschardynin; als der in die Ballerina
Vera Nevolina (Vera Karalli)
verliebte, hochverschuldete Wladimir) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1915: Ruslan und Ludmilla / Ruslan i Lyudmila (R: Władysław
Starewicz; nach dem Vers-Märchen
"Ruslan
und Ljudmila" von Alexander
Puschkin; als Fürst Ruslan) → IMDb
- 1915: Nikolaj Stavrogin / Nikolay Stavrogin (nach dem Roman
"Die
Dämonen" von Fjodor
Dostojewski;
R: Jakow
Protasanow;
als Nikolai Stawrogin) → IMDb
- 1915: Natascha Rostova (frei nach dem Roman "Krieg
und Frieden" von Leo
Tolstoi; R: Pjotr Iwanowitsch Tschardynin;
mit (Vera Karalli)
in der Titelrolle der Natascha Rostow; als ?) → IMDb
- 1916: Pique Dame / Pikovaya dama (nach der gleichnamigen
Erzählung von Alexander
Puschkin;
R: Jakow Protasanow; als der junge Pionieroffizier
Hermann) → Wikipedia (englisch)
- 1917: Andrey Kozhukhov (nach einer Vorlage des russischen Revolutionärs
Sergei Michailowitsch Krawtschinski;
R: Jakow Protasanow; als Andrey Kozhukhov) → IMDb
- 1917: Der triumphierende Satan / Satana likuyushchiy (R: Jakow
Protasanow; als Pastor Talnoks sowie dessen
Sohn Sandro; Kurzinfo: Pastor Talnoks kämpft vehement gegen
die Versuchungen des Lebens an, doch
er selbst wird Opfer dieser Versuchungen. In seinem Haus erscheint Satan (Aleksandr Chabrov,
1888–1935) und
treibt den Protagonisten zu kriminellen Handlungen und schließlich in
den Wahnsinn) → IMDb
- 1918: Pater
Sergius / Otez Sergi (nach der Erzählung "Vater
Sergej" von Leo
Tolstoi; R: Jakow
Protasanow;
als Fürst Stepan Kassatski, später der asketische Einsiedler Pater
Sergius)
- Produktionen in Frankreich
- 1920: Ein beunruhigendes Abenteuer / L'angoissante aventure (R: Jakow Protasanow;
als Henri de Granier;
auch Mitarbeit am Drehbuch; Kurzinfo: Der Marquis de Granier möchte, dass sein Sohn
Charles (Dimitri
Buchowetzki) seine derzeitige Geliebte für eine respektable Ehe
verlässt. Sein jüngerer Bruder
Octave (Alexandre Colas) versucht zu helfen, aber Yvonne Lelys (Nathalie
Lissenko) betrügt ihn und er verlässt
beinahe seine Familie für die Tänzerin. Er folgt ihr sogar nach Konstantinopel. Er schläft ein, während er seinem
Vater schreibt, und träumt davon, dass er ein Filmschauspieler sei, der sich aus Armut in das Haus seines Vaters
schleicht, um ihn auszurauben. Als sein Vater ihn erwischt, tötet er ihn. Zum Glück war alles ein Traum.
Anmerkung: Der Film wurde während der Reise von Jakow Protasanow und seiner Truppe nach Frankreich,
während Zwischenstopps gedreht und in Paris fertiggestellt.) → IMDb
- 1921: Justice d'abord (R: Jakow Protasanow;
Remake von "Prokuror" (1917); als ?;
Kurzinfo: Im Mittelpunkt des Melodrams steht ein schicksalhaftes Missverständnis zwischen zwei Liebenden.)
→ IMDb
- 1922: Tempêtes (R: Robert Boudrioz (1887–1949); als Henri;
Kurzinfo: Häusliches Drama
über eine
Frau (Nathalie Lissenko), die ihre Vergangenheit vor dem Mann verbirgt, den sie heiratet. Der Vater
ihres Kindes kehrt zurück und erpresst sie. Der Ehemann erfährt die Wahrheit.
der Rivale wird von der Polizei
gesucht und schützt sich, indem er sich dess Kindes bemächtigt. Er wird schließlich gefangen genommen,
tötet sich jedoch selbst, das Kind wird gerettet.) → IMDb
- 1922: Kean / Kean ou Desordre et Genie (nach dem Theaterstück
"Kean, ou désordre et génie"
von Alexandre Dumas d. Ä.; R:
Alexander
Wolkow; als der gefeierte Theaterschauspieler Edmund Kean)
→ IMDb
- 1922: Das geheimnisvolle Haus / La maison du mystère (nach einem Roman von Jules Mary (1851–1922);
R: Alexander Wolkow; als Textilmagnat Julien Villandrit, Eigentümer des Anwesens "Les Basses-Bruyères" und
Ehemann von Régine (Hélène Darly; 1900–1994), Eltern von Christiane (Francine Mussey; 1897–1933);
Charles Vanel
als Juliens intriganter
Rivale bzw. Jugendrfreund Henri Corradin; auch Drehbuch mit Alexander Wolkow)
→ stummfilm.at,
film.at,
Wikipedia (englisch)
- 1923: Ehegeschichten / Le brasier
ardent (als Zed, der Detektiv; auch Regie mit Alexander
Wolkow sowie Drehbuch;
Nathalie
Lissenko als die Ehefrau, Nikolai
Kolin als der Ehemann) → stummfilm.at
- 1924: Schatten, die vorüberziehen / Les ombres qui passent (R: Alexander Wolkow; als Louis Barclay;
Kurzinfo: Eine
Erbschaft führt einen Mann, der mit seiner liebevollen Gattin (Andrée Brabant; 1901–1989) sowie
seinem Vater (Henry
Krauss) glücklich auf dem Land lebte, nach Paris. Dort lässt ihn das weltliche Leben seine
Frau und sein bisheriges Leben vergessen. Zwei von seinem Vermögen angezogene Gauner bringen ihn dazu, eine
schöne und geheimnisvolle Frau (Nathalie Lissenko) kennenzulernen, in die er sich verliebt.)
→ IMDb
- 1924: Le lion des Mogols (R: Jean
Epstein; als Prinz Roundghito-Sing, Nathalie Lissenko als
Filmstar Anna)
→ stummfilm.at,
Wikipedia (englisch)
- 1926: Die zwei Leben des Mathias Pascal
/ Feu Mathias Pascal (nach dem Roman "Il fu Mattia
Pascal" von
Luigi
Pirandello; R: Marcel
L’Herbier; als Mathias Pascal) → prisma.de
- 1926: Michel Strogoff – Der Kurier des Zaren /
Michel Strogoff (nach dem Roman "Der
Kurier des Zaren";
("Michael Strogoff") von Jules
Verne; R: Viktor
Tourjansky; als Michael Strogoff) → Wikipedia (englisch)
sowie
die "Jules
Verne"-Seite von Andreas Fehrmann
- 1927: Casanova
/ Casanova (R: Alexander
Wolkoff; als Giacomo
Casanova; auch Drehbuch mit Norbert Falk
und Alexander Wolkoff)
- Weitere Produktionen (P = Produktion)
Tonfilme (Produktion: Frankreich)
- 1932: Sergeant X – Das Geheimnis des Fremdenlegionärs
/ Le sergent X (R: Wladimir
Strijewski;
als Jean Renault;
Kurzinfo: Die Ehefrau eines Armeeoffiziers heiratet erneut, nachdem sie glaubt, ihr russischer
Ehemann sei im
Kampf gefallen. Als dieser jedoch lebend zurückkehrt, meldet
er sich lieber bei der Fremdenlegion,
um das neue
Glück seiner einstigen Gattin nicht zu stören.) → Wikipedia (englisch),
Zensurentscheidung
- 1933: La mille et deuxième nuit (R: Alexander
Wolkow; als Prinz Tahar; Kurzinfo: Ein arabischer Prinz
gerät in
eine Gruppe Rebellen und zieht den Zorn eines widerwärtigen
Sultans
(Gaston Modot) auf sich, mit dessen
Ehefrau (Tania Fédor; 1905–1985) er zudem ein Verhältnis hat.) → IMDb
- 1934: Les amours de Casanova / Casanova (R: René Barberis (1886–1959); als
Giacomo
Casanova) → Wikipedia (englisch)
- 1934: Karneval des Lebens / L'enfant du carnaval (R: Alexander
Wolkow; als Henri Strogonoff; auch Drehbuch
mit Jean
Sablon) → IMDb
- 1936: Nitschewo / Nitchevo (R: Jacques
de Baroncelli; als Offizier Meuter; Kurzinfo: Der Kommandant
(Harry
Baur)
des U-Boots "Nitchevo" verdächtigt seine Frau Thérèse (Marcelle
Chantal) der Untreue, als sie sich an den 2. Offizier
Hervé de Kergoët (Georges
Rigaud) wendet. Dieser soll ihr helfen, ihren einstigen Freund, den Waffenhändler
Sarak (Jean-Max; 1895–1970)), auszuschalten. der sie wegen ihrer bewegten Vergangenheit erpresst.)
→ Wikipedia (englisch),
IMDb
|
|

