So schrieb unter anderen die Wiener Zeitschrift "Sport & Salon"1) Mitte Februar 1900: "(…) Der Letzten Einer ist Ferdinand Bonn, der gegenwärtig am
"Raimundthcater"1) ein auf fünfzehn Abende berechnetes Gastspiel absolvirt. Ferdinand Bonn ist ein grosser,
ein eigenartiger Künstler, dessen unleugbares Genie ihn mit Naturnothwendigkeit aus der Bahn des Schablonenhaften herausdrängt. Er bricht mit dem Traditionellen,
er lehnt sich nicht an die alte, sondern schafft sich seine Schule, jene Schule, die ihm eigene Wege weist.
Und so ist er eng verwandt mit Josef Kainz1), der ja auch seine
Bühnengestalten nicht nach irgend einem Vorbilde formt, sondern sie auf die Bühne stellt als den Ausfluss seines
ureigensten, künstlerischen Empfindens.
Seitdem wir Ferdinand Bonn das letztemal gesehen haben, ist er entschieden gewachsen, ist er herangereift bis
zur vollendeten Meisterschaft. Ob er uns nun in der düsteren Gestalt des dänischen Prinzen
Hamlet entgegentritt, ob er uns in Grillparzer’s "Jüdin von
Toledo"1) den in den Banden einer für ihn neuen, glühend heissen Liebe schmachtenden
König Alphons1) vorführt, oder ob er als Titelheld
seines, des Künstlerautors eigenem Lustspiele "Kiwito" ein tadelloses Cabinetstück liefert, überall sehen wir das
Walten einer Künstlernatur, welche den Stempel einer ausgesprochenen Individualität an sich trägt.
"Hamlet* ist in letzter Zeit in sehr verschiedenen Gestalten über die Wiener Bühnen gegangen: Josef Kainz,
Adele Sandrock und
Sarah Bernhardt haben
uns, jeder nach seiner Auffassung, den dänischen Prinzen vorgeführt, und es wurden damals so entsetzlich viele Vergleiche angestellt,
dass man schon anfing, mit Shakespeare ob der Schaffung dieses, als Versuchskaninchen schon ganz zerzausten Dramas zu grollen.
Und trotz alledem hat Bonn's "Hamlet" nicht nur stürmischen Beifall, sondern wirkliches, lebhaftes Interesse gefunden.
Es ist eine künstlerisch lebendige Darstellung, in der echte Naturtöne und fein Empfundenes mit gesuchteren, theatralischen Nuancen
wechseln, die einen fesselnden Reiz besitzt und durch die Einheitlich keit der Auffassung überrascht und hinreisst.
Fast noch vollendeter als sein "Hamlet" ist Bonn’s "König Alphons der Edle". Das Mienen- und Geberdenspiel
des Künstlers feiert hier seine höchsten Triumphe und erweckt in uns unwillkürlich Erinnerungen an
Eleonora Duse, die ja
bekanntlich auf diesem Gebiete unumstrittene Meisterin ist. In der Scene, da die von ihm so heiss geliebte
"Rahel" in seiner Gegenwart den "Don Garceran" mit allen Mitteln ihrer unwiderstehlichen
Verführungskunst an sich zieht, bringt Bonn die in dem Prinzen tobenden Seclenkämpfe, das wirre Durcheinander
von Liebe, Eifersucht, Rachgier und eines aufdämmernden Pflichtbewusstseins durch sein stummes Spiel so meisterhaft
zur Darstellung, dass schon um dieser einen Scene willen sein
"Alphons" als eine künstlerisch vollendete Leistung bezeichnet zu werden verdient. Und dass er,
ohne nach den so beliebten und gerade in dieser Rolle so nahe liegenden Bühneneffecten zu haschen, sich auch
im Momente des höchsten Affectes nicht zu unkünstlerischen Kraftproben seiner Lunge hinreissen lässt, das
beweist er im fünften Acte, da er in wilder Verzweiflung sich über den entseelten Körper der Geliebten wirft
und sich auch in diesem Augenblicke eine wohlthuende Mässigung auferlegt."
(Quelle: anno.onb.ac.at)
1905 gründete Bonn in Berlin "Ferdinand Bonns Berliner Theater",
wo zahlreiche von ihm selbst
geschriebene Bühnenstücke zur Uraufführung gelangten. Laut Peter W. Marx1) bekannte sich
Bonn "zu einem ästhetischen Stil, der gezielt eine überbordende Ausstattung und
allerlei Bühneneffekte einsetzte".2)
Seine Direktion des "Berliner Theaters" dauerte nur zwei Jahre und war, so befindet der Theaterhistoriker Peter W. Marx,
"künstlerisch und ökonomisch ein Fehlschlag".2)
Dennoch "machte Bonn sich und sein Theater zum Stadtgespräch"2), unter anderem
durch den Einsatz von lebenden Tieren auf der Bühne. Er adaptierte Erzählungen von
Arthur Conan Doyle1) um
den Meisterdetektiv Sherlock Holmes1) mit
sich selbst als Holmes, darunter in den 1910er Jahren die
berühmte Geschichte "Der Hund von
Baskerville"1). Bonns
patriotisches Bühnendrama "Der junge Fritz" wurde von Kaiser Wilhelm II.1), der noch eine der Sherlock-Holmes-Aufführungen besucht
hatte, verboten, worauf der Autor Bonn heftig reagierte. 1911 inszenierte
er im "Circus Busch"1) das Shakespeare Drama "Richard III."1), wobei
er selbst die Titelrolle des Richard III.1) übernahm. Die spektakuläre, von der Kritik weitgehend abgelehnte Aufführung war besonders
gekennzeichnet durch den Einsatz zahlreicher lebender Pferde, was ihm den Spottnamen
"Pferdinand" eintrug. Noch vor dem Ersten Weltkrieg musste er
mit seinem Unternehmen Konkurs anmelden und ging dann wieder auf Theatertournee.
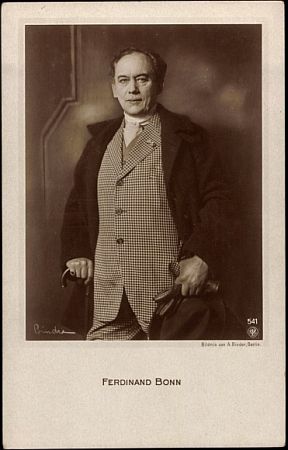
|
Ferdinand Bonn war auf den renommierten Bühnen Berlins zu Hause,
feierte Erfolge am "Deutschen Theater"1), am "Theater des
Westens"1) und am "Königlichen Schauspielhaus"1),
gestaltete die großen Helden des klassischen Theaters, aber auch der
Moderne. Unter anderem erlebte man ihn in Max Reinhardts1) ersten,
legendären Aufführung des Dramas "Dantons
Tod"1) von Georg Büchner1) am
16. Dezember 1916 im Berliner "Deutschen Theater",
hier glänzte Bonn mit der Titelfigur des Georges Danton1) an der Seite nicht minder
brillanter Kollegen – Bruno Decarli
gab den Revolutionsführer Robespierre1), Werner Krauß
den St. Just1).
Beim noch jungen Medium Film begann Bonn Anfang der 1910er Jahre
in einigen Produktionen der "Nordisk
Film"1), lieferte anfangs das Drehbuch zu
"Das
Millionentestament"1) (1911,
"Millionobligationen") mit Alwin Neuß
als Sherlock Holmes1) ab, um dann selbst vor der Kamera aktiv zu
werden. Aufmerksamkeit erregte er 1913 als der auch von ihm
verehrte Bayernkönig Ludwig II.1) in dem als
verschollen geltenden Streifen "Ludwig II. von Bayern",
den er zudem mit seiner Berliner "Bonn-Film" selbst
produziert hatte und in dem als Statisten auch die Bernauer
Bevölkerung agierte. Bonn hatte den Film unter anderem.in seinem 1908 erworbenen Schlösschen in
Bernau am Chiemsee1)
hergestellt, das er zu einer kleinen "Filmfabrik" umfunktioniert hatte (das heutige Hotel
"Bonnschlössl"). Es war der erste Spielfilm über den legendären
Bayernkönig Ludwig II.,
Anerkennung erfuhr Bonn vom bayerischen König
Ludwig III.1), dem er das Werk in
einer Privatvorführung präsentieren durfte (Quelle: drummerundarns.de)
Ferdinand Bonn vor 1929
Urheber: Alexander
Binder1) (1888 – 1929)
NPG-Karte 541;
Quelle:
cyranos.ch;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
Es folgten prägnante bzw. tragende Rollen in Stummfilmen wie "Svengali"1) (1914)
nach dem Roman "Trilby"1)
von George du Maurier1),
"Der
Katzensteg"1) (1915)
nach dem Roman von Hermann Sudermann1) oder
in dem Lustspiel "Hampels
Abenteuer"1) 1915)
mit mit Georg Baselt1) in der Titelrolle. In "Robert
und Bertram"1) (1915)
nach der Posse von Gustav Raeder1) bildete er gemeinsam mit Eugen Burg
"die beiden "lustigen Vagabunden", in dieser spaßigen Geschichte
war auch der berühmte Ernst Lubitsch1)
(1892 – 1947) als gewiefter Kommis Max Edelstein zu
sehen. 1914 zeigte sich Bonn in dem nach einem Drehbuch von Richard Oswald1)
realisierten Krimi "Sherlock Holmes contra Dr. Mors"3)
erstmals als Meisterdetektiv Sherlock Holmes auf der Leinwand, den
Gegenspieler Dr. Mors mimte Friedrich Kühne.
Die Story basierte auf Bonns 1906 uraufgeführten Detektiv-Komödie "Sherlock Holmes"3)
→ Foto einer Aufführung am "Berliner
Theater"1) bei Wikimedia Commons. Zwischen 1917 und 1919
trat er dann noch mehrfach als Holmes in Erscheinung. Die "Kinematografische Rundschau"1)
vom 1. November 1914 notierte zu Bonns Holmes-Darstellung
unter anderem folgendes: "Sein Sherlock Holmes weicht schon im
Äußeren von der landesüblichen Detektivfigur ab. Gar nichts
windhundartig schlankes, englisch lebloses. Das ist ein behäbiger,
wohlgenährter deutscher Detektiv, der auch dem sprichwörtlichen
Pfeifchen aus dem Wege geht und seine guten Importe als
Nervenberuhiger in die Welt dampft. Niemals der kühn forschende
Gedankenathlet, immer der possierlich lächelnde gutmütige, aber
nicht weniger erfinderische Geheimpolizist."
|
Der Schauspieler zeigte sich neben verschiedenen Krimis in Melodramen wie
"Don Juans
letztes Abenteuer"1) (1918)
oder "Die
goldene Mumie"1) (1918), mimte
in dem von Friedrich Zelnik nach dem
Roman "Manon Lescaut"1)
von Abbé Prevost1) mit Ehefrau Lya Mara in der Titelrolle
gedrehten Streifen "Manon.
Das hohe Lied der Liebe"1) (1919)
als Marschall des Grieux den Vater des Chevalier des Grieux (Fred Goebel1)) oder
unter der Regie von Rolf Raffé1) einmal mehr den (nun älteren) Märchenkönig Ludwig II. in
"Das Schweigen am Starnberger See. Schicksalstage
Ludwig II., König von Bayern" (1921); der junge Ludwig wurde von
Martin Wilhelm (1881 – 1954) dargestellt, Bonns dritte
Ehefrau Henriette Ida, genannt"Addy" (geborene Homberg, 1892–1982), spielte die Rolle der Prinzessin
Sophie
in Bayern1), die Rolle der Kaiserin Elisabeth von Österreich1) übernahm Raffés Frau
Carla Nelsen-Raffé4) (1897 – 1988) →
drummerundarns.de.
Der "bleiche Märchenkönig" (F.B.) hatte Bonn schon immer fasziniert, wie er in seinen Memoiren
"Mein Künstlerleben" (1920) unumwunden gesteht: "Als Kind sah ich Ludwig
den Zweiten, den königlichen Jüngling vorüberschreiten, göttlich,
voll Majestät und Anmut. Hinter goldgleißenden Priestern,
die bei der Prozession die blitzende Monstranz in Weihrauchwolken trugen,
wandelte er – die Mensch gewordene Schönheit. Kein Gemälde, kein Drama, kein Naturereignis hat jemals stärker auf mich
gewirkt.".5)
Ferdinand Bonn, fotografiert von dem königlich bayerischen Hoffotografen
Franz Grainer1) (1871–1948); Photochemie-Karte Nr. 2775;
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
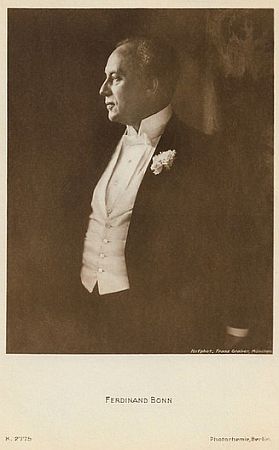
|
Oft verkörperte Bonn hochrangige Personen aus Adelskreisen wie den
Adelsmarschall bzw. Vater des von Friedrich Zelnik
dargestellten
Titelhelden in dem Melodram "Graf
Michael"1) (1918) nach einer Erzählung
von Carl Hauptmann1), den Grafen
Cosimo da Ponte in dem verschollenen Drama "Das Werkzeug des
Cosimo" (1919) oder vor allem den Kaiser Wilhelm II.1)
in "Kaiser Wilhelms Glück und Ende" (1919).
Letztgenannter Streifen, in dem Bonn sich in einer Episode auch als
der als "Hauptmann von Köpenick" bekannten Schuster Wilhelm Voigt1)
zeigte, sorgte für einen handfesten Skandal in der
noch jungen Weimarer Republik1) und fiel der Zensur zum Opfer, da er
angeblich den Kaiser der Lächerlichkeit aussetze und somit die
"Gefahr deutschnationaler Unruhen" hervorrufe.
Wilhelm II. selbst hatte aus seinem holländischen Exil
protestiert, alle Filmkopien sollen vernichtet worden sein. "Kaiser Wilhelms Glück und Ende" sei noch
am Vortag der Uraufführung vom Innenministerium verboten worden. Der Film
stelle eine Geschmacklosigkeit dar und sei geeignet, das Ansehen
der deutschen Filmindustrie zu beschädigen.6)
schrieb damals unter anderem "Der Kinematograph"1) (667,
1919 S. 25–27) → PDF-Datei bei filmportal.de).
Und bei Wikipedia kann man lesen: "Für Ferdinand Bonn besaß
seine kritische Darstellung des Monarchen zugleich auch eine persönliche
Bedeutung. In "Das
große Personenlexikon des Films"1)
heißt es dazu: Es war eine späte Revanche an Deutschlands
Herrscher, der einst Bonns Karriere torpedierte, nachdem dieser mit
einem harschen Brief auf das Verbot seines patriotischen Bühnendramas"Der
junge Fritz" durch Wilhelm II. reagiert und den
Kaiser verbal attackiert hatte."
Als Dichter Ana tauchte Bonn in dem von Mihály Kertész1) nach dem Roman "The Moon
of Israel" von Henry Rider Haggard1)
mit María Corda als das jüdische Sklavenmädchen Merapi realisierten Monumentalfilm "Die
Sklavenkönigin"1) (1924)
auf, der die biblische Geschichte des Auszugs
aus Ägypten1) aufgriff und mit rund
5.000 Statisten entstanden war. In dem Drama "Der
Fluch"1) (1925) mit Oskar Beregi in der Hauptrolle
eines weltlichen Juden war er der Rabbi Eliser,
in dem Verfilmung "Der
Bankkrach unter den Linden"1) (1926)
nach dem Roman "Der Herr auf der Galgenleiter" von Hugo Bettauer1) der Cellist Wolfgang Amadeus,
in der Komödie "Eine
tolle Nacht"1) (1927) nach der Posse
von Julius Freund1) der Dorforganist/Küster Ruhesanft und
in der amüsanten Geschichte "Gustav Mond – Du gehst so stille1) (1927) von (Regie) und mit
Reinhold Schünzel als Gustav Mond der Vater der flotten Frieda Krause (Käthe von Nagy). Seinen
letzten Stummfilm drehte er unter der Regie von Victor Janson und spielte in "Donauwalzer" (1930)
den Prinzen Waldmannsdorff an der Seite von unter anderem Harry Liedtke,
Harry Hardt
und Adele Sandrock
→ Übersicht Stummfilme.
Der als eigenwillig geltende Schauspieler, der im Laufe seiner
Karriere in über 70 Kinoproduktionen mitwirkte, machte sich
zudem, verschiedentlich unter den Pseudonymen "Florian Endli",
"Franz Baier" und "Hanns Witt-Ebernitz",
als Autor einen Namen, konzentrierte sich vor allem nach dem
1. Weltkrieg auf seine schriftstellerische Tätigkeit. Aus seiner
Feder stammten Dramen, Komödien, Lustspiele, Tragödien und das
"vaterländische" Schauspiel "Friedrich II. König
von Preußen". Er verfasste auch humoristische Erzählungen und
arbeitete an seinen Memoiren, die gute Einblicke in das Theater- und
Gesellschaftsleben seiner Zeit gewähren.7) → Werke Bonns bei
Wikipedia
Der vielseitige Künstler Ferdinand Bonn starb am 24. September 1933 im Alter vom
71 Jahren in Berlin.
Laut Wikipedia war der Schauspieler mit Maria Bonn
(1871 – 1909), einer Schwester der Opernsängerin
Emma Moerdes1),
verheiratet.
Im Jahre 1908 verschlug es den Künstler wegen diverser Theater-, Film- und Presseskandale fluchtartig
aus der Großstadt Berlin ins ländliche Bernau1), wo er zusammen mit seiner damaligen Frau Maria Bonn (1871 – 1909)
eine großzügige Villa mit Park erwarb: Das noch heute existierende, nach ihm
benannte "Bonnschlössl", das seit 1965 als Hotel genutzt wird. Mit seiner dritten Frau Addy
(1892 – 1982) lebte der Schauspieler dort bis zu seinem Tod im Jahre 1933. Auf dem nahen
Kirchfriedhof findet man ihre Gräber. Bernau ehrte den zeitlebens passionierten Reiter Ferdinand Bonn im Jahre 1958
durch die Benennung einer Straße mit seinem Namen. (…) Gründe
für Bonns schauspielerische Erfolge waren sein natürliches Spiel, eine
enorme Wandlungsfähigkeit und das Talent zur Improvisation. In einem Porträt
aus dem Jahre 1927 bewunderte Kurt Tucholsky1) dessen Handwerk und
"Selbstverständlichkeit des Könnens": "Es waren so subtile
Kleinigkeiten, die unsereiner nur an der Wirkung fühlt, am meisten dann, wenn
sie nicht da sind: Atemtechnik, die Art, wie die Rede ansetzt, die ruhige
Sicherheit der Akzentgebung – er konnte das. Er hatte das hundertmal
ausprobiert, er wußte Bescheid, er hatte es gelernt! Alte Schule."5)
Und
in dem Artikel bei www.friedenau-aktuell.de
kann man lesen: "Nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau Maria heiratet Ferdinand Bonn 1917 Henriette Ida genannt
"Addy" geb. Homberg (1892 – 1982). Sie bringt Tochter Marion Wüster (1910 – 1985) aus ihrer ersten Ehe
mit Adolf Wüster (1888 – 1972) mit ins Schlössl. 1926 macht Addy Bonn aus dem Schlössl ein Kinderheim. 1933 stirbt Ferdinand Bonn. Seine Stieftochter
Marion Wüster heiratet Werner Paul (1913 – 1994). 1966 verkauft Addy Bonn Schlössl und Park an die Familie Stolz. Sohn Robert übernimmt Gasthof und Metzgerei
"Alter Wirt", Bruder Reinhard das "Bonnschlössl", das derzeit in 10 Ferienwohnungen umgewandelt wird."
| Die "Neue Zürcher Zeitung"1) (NZZ) schrieb am 27. September 1933 (Abendausgabe, Nr. 1741) in
einem Nachruf: "Qualis artifex! Seine Schattenseiten vermochte jeder zu sehen. Er
war ein Komödiant vom reinsten Blute, der sich
selbst zum Star erhob, ehe der Begriff von Amerika aus seine Weltreise antrat. Rollen spielen
genügte seinem Ehrgeiz nicht, er wollte die Rolle des Alleskönners spielen.
Wenn keine Stücke
für sein Protagonistentum da waren, schrieb er sich selbst welche auf den Leib. So kam er einmal
als getarnter Schweizer Florian Endli mit dem Schmarren "Andalosia", der zu einem denkwürdigen
Theaterskandal in Berlin führte. Waren passende Rollen da, so wurden sie von ihm ausgeschmückt durch Geigensoli oder einen Einzug hoch
zu Roß. Oft genug war er dicht daran, als Held eine komische Figur zu werden. Dann brach die
ganze Herrlichkeit zusammen. Lorbeerbaum und Bettelstab. Als er wieder kam, schienen viele
Schlacken von ihm abgefallen. Er fing an, in der zweiten Reihe zu glänzen. Plötzlich wurde man
inne, wie viel er wirklich konnte. Er brauchte nur den Mund aufzutun, und sein sonores Organ, in
Possarts Schule gebildet, konnte den jungen Menschen auf der Bühne zeigen, daß Sprechen gelernt
sein will, Versesprechen erst recht. Bonn war ein außerordentlicher Sprecher voll Wohlklangs in
der Stimme. Doch er konnte auch, in strenger Zucht, ein trefflicher Charakteristiker sein. Nun
ist er, fast 72 alt, schon halb vergessen, in Walhall eingezogen."8)
Ferdinand Bonn vor 1929
Urheber: Alexander
Binder1) (1888 – 1929); Photochemie-Karte Nr. 1742;
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
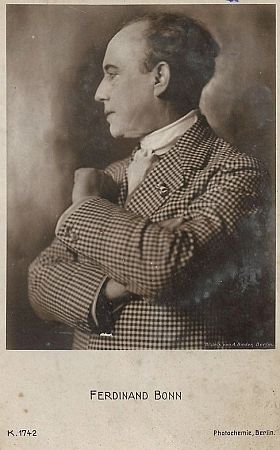 |
|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database,
filmportal.de
sowie
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"
(Fremde Links: Wikipedia, sherlockholmes.wikia.com,
filmportal.de, R = Regie) |
Stummfilme (Auszug)
- Als Drehbuch-Autor
- Als Darsteller
- 1911/1912: Produktionen der "Nordisk Film"
- 1912: Herzenskämpfe
/ Hjerternes Kamp (R: August Blom;
als Karl Mahn, Bruder von Albert (Robert
Dinesen))
- 1912: Die Tragödie einer Mutter / En moders kaerlighed (R: Peter Lykke-Seest (1868–1948); mit
Augusta Blad;
als der Vater) → IMDb
- 1912: Elskovs magt (R: August Blom; mit Augusta Blad; als
Cordt) → IMDb
- 1912: Seine schwierigste Rolle / Hans vanskeligste Rolle (R:
August Blom; als Schauspieler Kurt Barner) → IMDb
- 1913: Ludwig II. von Bayern (Dokumentarfilm;
als Bayernkönig Ludwig
II.; auch Drehbuch/Produktion)
→ drummerundarns.de (Textteil "Ludwig Bonns Ludwig II. von Bayern"), Early Cinema Database
- 1914: Svengali
(nach dem Roman "Trilby"
von George
du Maurier; R: Luise
Kolm, Jakob
Fleck; als der hypnotisch
veranlagte Svengali)
- 1914: Die
Geschichte der stillen Mühle (nach einer Novelle von Hermann
Sudermann; R: Richard
Oswald;
als David, ein alter Mühlknecht)
- 1914: Lache,
Bajazzo! (R: Richard Oswald; mit Rudolf
Schildkraut in der Titelrolle; als Herbergsvater)
- 1914: Wamperl im Orient (R: ?; als Hauptdarsteller)
→ Early Cinema Database
-
1914–1919: "Sherlock
Holmes"-Filmreihe (R: Carl
Heinz Wolff)
- 1915: Der
Katzensteg (nach dem Roman von Hermann
Sudermann; R: Max
Mack; als der alte Hackelberg,
Vater der Dienstmagd Regine (Leontine
Kühnberg))→ filmportal.de
- 1915: Hampels
Abenteuer (R: Richard
Oswald; mit Georg
Baselt in der Titelrolle; als Theaterdirektor Striese) → filmportal.de
- 1915: Robert
und Bertram. Die lustigen Vagabunden (nach der Posse von Gustav
Raeder; R: Max Mack;
als Landstreicher Bertram, Eugen
Burg als Robert) → filmportal.de
- 1916: Hoffmanns
Erzählungen (nach Motiven aus der gleichnamigen
Oper von Jacques
Offenbach, die wiederum auf
einigen Novellen von E.
T. A. Hoffmann beruht; R: Richard Oswald; mit Erich
Kaiser-Titz als der ältere
E. T. A. Hoffmann; als Stadtrat Lindorf) → stummfilm.at,
filmportal.de
- 1916: Professor Erichsons Rivale (R:
Louis Neher;
mit Max Landa
als Kriminalrat Dr. Nemo; als Prof. Erichson)
→ Early Cinema Database
- 1917: Der
Erbe von Het Steen ("Phantomas"-Reihe;
mit Erich
Kaiser-Titz: Phantomas; R: Louis
Neher; als ?)
- 1917: Der Verräter (von
(Co-Regie mit Carl
Boese) und mit Georg
Alexander; als ?) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Flüssiges Eisen (R: Heinz Karl Heiland;
als ?) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Der Spion
(R: Heinz Karl Heiland;
als Anzio, der Spion)
- 1917: Fünf Fingermale (R: Georg Victor Mendel;
als Detektiv James Patterson) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Ihr Sohn (nach
Novelle "Franz Popjels Jugend" von Carl
Hauptmann; R: Willy
Zeyn sr.; mit Friedrich Zelnik
als Franz Popjel; als dessen Bruder Eduard)
- 1917: Das Rätsel der Kassette
(R: Heinz Karl Heiland;
als der Altgeselle) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1918: Farmer Borchardt (R:
Carl
Boese; als Borchardt) → Early Cinema Database
- 1918: Don
Juans letztes Abenteuer (R: Heinz Karl Heiland; als Lucian
Andrassy)
- 1918: Die
goldene Mumie (R: Richard
Eichberg; als der berühmte Ägyptologe Prof. Mäander / der
Pharao)
- 1918: Graf Michael (nach
einer Erzählung von Carl Hauptmann;
R: Alfred
Halm; mit Friedrich
Zelnik in der
Titelrolle; als dessen Vater, der Adelsmarschall)
- 1918: Um die Liebe des Dompteurs. Das Drama im Zirkus Sarasani (R: Heinz Karl Heiland;
als Janaya) → IMDb
- 1919: Kaiser Wilhelms Glück und Ende (R:
Willy
Achsel; als Kaiser
Wilhelm II.und
der "Hauptmann von Köpenick" genannte
Schuster Wilhelm
Voigt; auch Drehbuch mit Alfred
von Funke)
- 1919: Das Werkzeug des Cosimo (R:
Alfred
Halm; als Conte Cosimo da Ponte)
- 1919: Der Gürtel der Basthi (R: Carl
Heinz Wolff; als ?) → Early Cinema Database
- 1919: Die Prostitution
(Zwei Teile; R: Richard
Oswald)
- 1919: Manon.
Das hohe Lied der Liebe (nach dem Roman "Manon Lescaut" von
Abbé Prevost; R:
Friedrich
Zelnik
mit Ehefrau Lya
Mara in der Titelrolle der Manon Lescaut; als Marschall des
Grieux, Vater des
Chevalier des Grieux (Fred
Goebel))
- 1919: Leichtsinn und Lebewelt (R:
Friedrich Zelnik: als Graf Warnstorff) → Early Cinema Database
- 1919: Die Madonna mit den Lilien (R: Friedrich Zelnik: als Fürst Cesare Torelli) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Menschen in Ketten
(R:
Karl
Grune; als Werftdirektor Van Bogaers)
- 1919: Die Mexikanerin
(R: Carl Heinz Wolff; als ?)
- 1919: Hölle der Jungfrauen
(R: Friedrich Zelnik; als ?)
- 1919: Der
neue Herr Generaldirektor (R: Hans
Werckmeister; als ?) → Early Cinema Database
- 1920: Salome (R:
Eugen
Burg; mit Wanda
Treumann als Salome; als der Präsident Filippe Hero)
- 1920: Die Geheimnisse von
London. Die Tragödie eines Kindes (frei nach Motiven
aus ""Oliver
Twist" von
von Charles
Dickens; R: Richard
Oswad; mit dem der ungarischen Kinderstar Tibor
Lubinszky; als Aufseher Bumble)
- 1920: Das
vierte Gebot / Martin Schalanters letzter Gang. Eine Elterntragödie
(nach dem Stück "Das
vierte Gebot"
von Ludwig
Anzengruber; R: Richard Oswald; mit Louis
Ralph als Martin Schalanter; als der reiche Lebemann
Stolzenthaler, später Gatte von Hedwig Hutterer (Lola
Urban-Kneidinger))
- 1921: Das Schweigen am Starnberger
See. Schicksalstage Ludwig II., König von Bayern (R: Rolf Raffé;
als der ältere
Ludwig II.,
Martin Wilhelm (1881–1954) als der jugendliche Ludwig) → IMDb
- 1922: Die Schuldigen / Das neunte Gebot; Kain und Abel (R:
Fritz
Freisler; als ?) → IMDb
- 1924: Lumpen
und Seide
(R: Richard
Oswald; als Vater von Hilde (Mary
Kid)) → stummfilm.at,
filmportal.de
- 1924: Die
Sklavenkönigin (nach dem Roman "The Moon of
Israel" von Henry
Rider Haggard, basierend auf der
biblischen Geschichte vom Auszug
aus Ägypten; R: Mihály
Kertész (= Michael Curtiz); mit María
Corda als
das jüdische Sklavenmädchen Merapi, "The Moon of
Israel"; als Dichter Ana) → filmportal.de
- 1925: Der Fluch
(R: Robert
Land; mit Oskar
Beregi in der Hauptrolle eines weltlichen Juden; als Rabbi Eliser)
→ stummfilm.at,
filmportal.de
- 1926: Der goldene Schmetterling
(nach einer Vorlage von P.
G. Wodehouse; R: Michael
Kertész; als Theaterdirektor)
→ filmportal.de
- 1926: Im weißen Rößl (nach
dem Alt-Berliner Lustspiel von Oskar
Blumenthal und Gustav
Kadelburg; R: Richard
Oswald;
mit Liane
Haid als Rößlwirtin Josefa Vogelhuber, Max
Hansen als Zahlkellner Leopold; als Bauer) → stummfilm.at,
siehe auch das gleichnamige
Singspiel von Ralph Benatzky
- 1926: Die Frau in Gold
/ Les voleurs de gloire (R: Pierre Marodon (?–05.04.1949);
als ?)
- 1926: Als ich wiederkam
(R: Richard
Oswald; Fortsetzung von "Im
weißen Rößl"; mit Liane
Haid als Rößlwirtin
Josefa Vogelhuber, Max
Hansen als Zahlkellner Leopold; als Bauer)
- 1926: Der Bankkrach unter den Linden
(nach dem Roman "Der Herr auf der Galgenleiter" von Hugo
Bettauer;
R: Paul
Merzbach; als Cellist Wolfgang Amadeus)
- 1927: Eine tolle Nacht
(nach
der Posse von Julius
Freund; R: Richard Oswald; als Ruhesanft, der Dorforganist/
Küster Ruhesanft in Essig an der Gurke) → stummfilm.at,
filmportal.de
- 1927: Da hält die Welt den Atem an
(nach dem Roman "Schminke" von Guido Kreutzer; R/Kino-Musik:
Felix
Basch
u. a. mit Marcella
Albani; als ein Revue-Autor) → filmportal.de
- 1927: Der Zigeunerbaron (nach
der gleichnamigen
Operette von Johann
Strauss (Sohn); R: Friedrich
Zelnik
mit Ehefrau Lya Mara als Saffi; mit Michael
Bohnen als Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter,
Wilhelm
Dieterle als Sandor Barinkay; als der Woiwode)
- 1927: Dr. Bessels Verwandlung
(nach einer Illustriertenroman-Vorlage von Ludwig
Wolff; R: Richard
Oswald;
mit Hans
Stüwe als Dr. Alexander Bessel; als Oberst Simon Jovanitsch)
→ stummfilm.at
- 1927: Der falsche Prinz
(R: Heinz
Paul; mit dem litauisch-russischen Abenteurer und Hochstapler Harry
Domela
als er selbst; als Intendant)
- 1927: Üb immer Treu und Redlichkeit
(von (Regie/Drehbuch mit Alfred
Schirokauer) und mit Reinhold
Schünzel; als ?)
→ filmportal.de
- 1927: Gustav Mond … Du gehst so stille (von
(Regie) und mit Reinhold Schünzel als Gustav Mond; als August Krause:
Käthe
von Nagy als dessen Tochter, die flotte Frieda Krause)
- 1928: Heut' spielt der Strauss
/ Der Walzerkönig (R: Conrad
Wiene; mit Imre
Ráday als Johann
Strauss (Sohn),
Alfred
Abel als Johann
Strauss (Vater); als Drechsler)
- 1928: Rasputins Liebesabenteuer (R:
Martin
Berger; mit Nikolai
Malikoff als "Geistheiler" Grigori
Rasputin;
als Jagoroff)
- 1929: Verirrte Jugend
(R:
Richard Löwenbein;
als Professor im Gymnasium)
- 1929: Die Frau im Talar
(nach dem Roman "Frřken Statsadvokat" von David
Dietrichs Svendsen Arnesen alias
Peter Bendow (1884–1959); R: Adolf
Trotz; mit Aud Egede-Nissen als Staatsanwältin Jonne
Holm, Paul
Richter
als Weltenbummler
Rolf Brönne, Neffe von Konsuls Backhaug (Fritz
Kortner); als ?) → filmportal.de
- 1930: Donauwalzer ((R:
Victor
Janson; als Prinz Waldmannsdorff)
-
Als Produzent ("Bonn-Film", Ferdinand Bonn, Berlin)
Tonfilme
|
|

