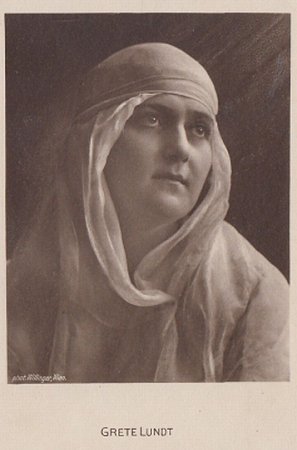
|
Grete Lundt (auch Lund) wurde am 20. Mai 1892 im damals zur k. u. k.
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn1) gehörenden
Stadt Temeschburg1) (heute:
Timișoara,
Rumänien) geboren. Sie stammte aus der Bevölkerungsgruppe der
Banater
Schwaben1), besuchte die Handelsschule,
arbeitete ab 1906 zunächst als Bürokraft und entschied sich dann
für einen künstlerischen Beruf. Nach Gesangs- und Tanzunterricht sowie
privatem Schauspielunterricht in Berlin bei Gertrud Arnold1)
(1873 – 1931), stand sie bei der "Wiener Kunstfilm"1) erstmals vor einer
Kamera und trat in dem von Louise Kolm1) und
Jakob Fleck1) in Szene gesetzten
Streifen "Der Traum eines österreichischen Reservisten"
in Erscheinung, der am 15. März 1915 zur Uraufführung gelangte und auf dem
gleichnamigen "Großen militärischen Tongemälde" von Carl Michael Ziehrer1)
aus dem Jahre 1890 basierte.
Von Fachwelt und Publikum als das "österreichische
Quo Vadis?" bezeichnet, wurde das Werk als "Filmepos aus
Österreichs Ruhmesjahr 1914–15 nach dem Tongemälde von C. M. Ziehrer. Verfaßt und inszeniert von Louise Kolm
und J. Fleck."
angekündigt → bildarchivaustria.at.
Nach zwei weiteren stummen Produktionen spielte Grete Lundt erneut unter der
Regie von Kolm/Fleck, so in deren ersten Verfilmung "Der
Meineidbauer"1) (1915)
nach dem gleichnamigen
Volksstück1) von Ludwig Anzengruber1)
mit Hermann Benke als der Kreuzweghofbauer Jacob Ferner und, ebenfalls
neben Behnke, in dem Drama "Die
Tragödie auf Schloß Rottersheim"1) (1916), wo sie als
Baronin Elsa, Gattin
von Baron Erich Hartwig (Karl Pfann1)) in Erscheinung trat.
Grete Lundt, fotografiert von Wilhelm Willinger1) (1879 – 1943)
Photochemie Karte K 2383
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
|
|
|
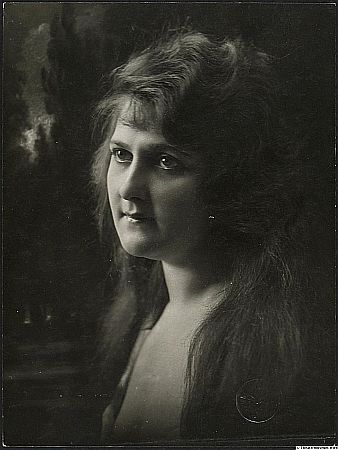
|
Mit nur 34 Jahren nahm sich Grete Lundt am 31. Dezember 1926 bzw. in der
Silvesternacht das Leben. In einer Notiz hieß es am 13. Januar 1927 in
"Das
interessante Blatt"1) (S. 4): "Die bekannte Filmschauspielerin Grete Lundt, die
lange Jahre hindurch eine der meisten beschäftigten
Kinoschauspielerinnen Berlins war, hat aus Verzweiflung über ihre pekuniäre
Lage und Engagementslosigkeit Selbstmord verübt. Sie wurde von dem aus seiner
Skandalaffäre berüchtigten Julius Barmat*) unterstützt, bis er verhaftet
wurde. Frau Lundt griff damals zu dem traurigen "Beruhigungsmittel"
des Morphiums, als jede Unterstützung aufhörte. Als sie schließlich in eine
Morphiumentziehungsanstalt gebracht werden musste, war sie nicht in der Lage,
die Kosten für diese Kur zu bestreiten und nußte ihre ganze Wohnung, Möbel
und Habseligkeiten verkaufen. Sie nahm Mengen Morphium und beging schließlich
auf einer Eisenbahnfahrt von Wien nach Berlin in einem Abteil des D-Zuges
Selbstmord durch Injizierung einer großen Dosis Morphium." → online bei
ANNO1)
*) → siehe Barmat-Skandal1)
Grete Lundt, fotografiert von
Wilhelm Willinger1) (1879 – 1943)
Quelle: kulturpool.at
von theatermuseum.at
Inventarnummer: FS_PA64442alt;
Lizenz: CC
BY-NC-SA 4.0
|
|

|
Quelle (unter anderem): Wikipedia,
cyranos.ch
Fotos bei filmstarpostcards.blogspot.com
|
Fremde Links: 1) Wikipedia
Lizenz Fotos Grete Lundt (Urheber: Wilhelm
Willinger): Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre
urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische
Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren Staaten mit einer
gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers.
|
|
|
|
|

