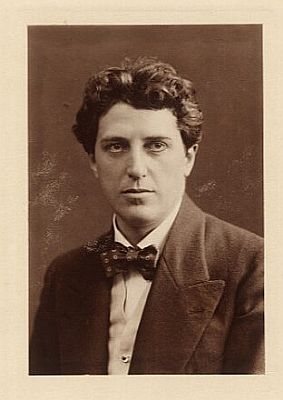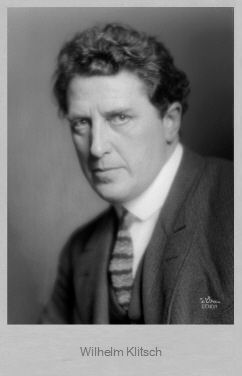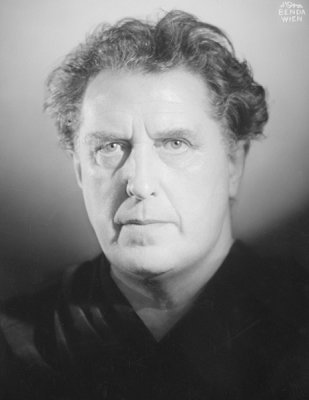|
Der am 25. November 1882 in Wien1), Metropole der damaligen
k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn1), geborene Wilhelm Klitsch
verstand sich in erster Linie als Theaterschauspieler, wirkte aber auch
in einigen frühen österreichischen Stummfilmproduktionen als Darsteller
mit. Der Sohn des Meerschaum-Drechslers Heinrich Klitsch, der zu den
k. u. k. Hoflieferanten gehörte, besuchte ein humanistisches Gymnasium und
ließ sich dann an der von Hofschauspieler Karl Arnau1) geleiteten Theaterschule
ausbilden.
Sein Bühnendebüt gab Klitsch 1901 am "Raimundtheater"1)
mit der Figur des Julius von Flottwell in dem Zaubermärchen "Der
Verschwender"1) von Ferdinand Raimund1), wechselte
dann 1902 für zwei Jahre an das "Stadttheater
Wiener Neustadt"1).
Anschließend ging er bis 1906 an das Wiener "Kaiserjubiläums-Stadttheater",
der heutigen "Volksoper"1) → Foto bei Wikimedia
Commons. Ab 1906 wirkte der Schauspieler am "Deutschen
Volkstheater"1), wo er mit zahllosen klassischen Heldenfiguren
aber auch Rollen in zeitgenössischen Stücken das Publikum zu überzeugen
wusste und bis Ende der 1920er Jahre vor allem wegen seiner vollendeten
Sprechtechnik viele Erfolge feierte. Gastspielreisen und Vortragsabende
führten ihn an namhafte Häuser in ganz Europa.
Wilhelm Klitsch, portraitiert von Viktor Angerer1) (1839–1894)
Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen
Nationalbibliothek1) (ÖNB)
Urheber: Viktor Angerer; Datierung: Unbekannt
Quelle/Rechteinhaber ÖNB/Wien, Bildarchiv;
Signatur: Pf 191 E1
|
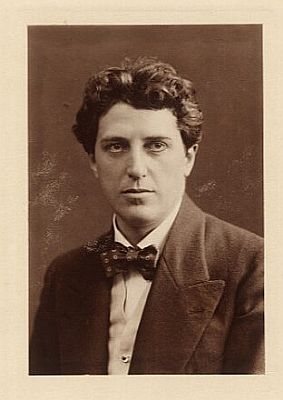 |
| Als Schiller-Interpret glänzte Klitsch unter anderem mit der
Titelrolle in
"Wilhelm Tell"1), als Karl Moor
in "Die Räuber"1)
als Max Piccolomini, in "Wallenstein"1)
und
als Marquis Posa in "Don Carlos"1), er gestaltete Goethes
"Egmont"1),
"Faust"1)
und "Götz von Berlichingen"1),
Shakespeares "Othello"1)
und "Hamlet"1)
oder den Wetter Graf vom Strahl in dem Ritterschauspiel "Das Käthchen von Heilbronn"1)
Heinrich von Kleist1), aber auch
als Protagonist in den Stücken"Peer Gynt"1)
und "Brand"1)
von Henrik Ibsen1) feierte
Klitsch Erfolge. Dem jugendlichen Helden entwachsen, brillierte er
beispielsweise als Kaiser Rudolf von Habsburg1) in
dem Trauerspiel "König Ottokars Glück und
Ende"1) Franz Grillparzer1), als Crespo Pedro in
dem Versdrama "Der Richter von
Zalamea"1) von Calderón de la Barca1) oder als
Tizefigur in dem Trauerspiel "Ahasver" von Ernst August Friedrich Klingemann1). |
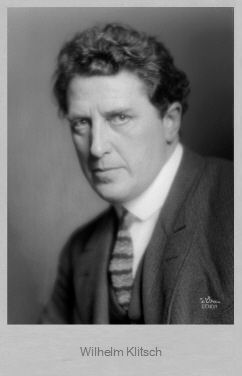 |
Seit Mitte der 1910er Jahre betätigte sich Klitsch für kurze Zeit beim
Film, trat – vom Kriegsdienst befreit – fast ausschließlich in Produktionen der ersten bedeutenden österreichischen Filmproduktionsgesellschaft
"Wiener Kunstfilm Ges. mbH"1)
unter der Regie der Firmengründer Jakob Fleck1) und dessen
späteren Ehefrau Luise Kolm1) auf, meist an
der Seite von Liane Haid. An ersten
Arbeiten vor der Kamera ist die tragisch endende, melodramatische Geschichte
"Auf
der Höhe"1) (1916)
nach einer Vorlage von Ludwig Ganghofer1) zu nennen, wo Klitsch den armen Gregor Stark mimte, der sich ein
besseres Leben wünscht und die Tochter des Försters (Liane Haid) entführt. Um "auf die
Höhe" des Lebens, also ganz nach oben, zu kommen, kennt er fortan
keine Skrupel.
Ebenfalls mit Liane Haid entstand der nicht minder
dramatische Streifen "Lebenswogen"1) (1916), wo
sich Klitsch als ehrgeiziger Arzt Dr. Erwin Lenk zeigte, der
schließlich sein Glück mit der Tochter (Haid) des Kommerzialrats
Berger (Hermann Benke) findet.
Porträt von Wilhelm Klitsch 1925
Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen
Nationalbibliothek1) (ÖNB)
Urheber: Atelier D'Ora-Benda (Madame d'Ora1),
1881–1963); Datierung: 10.03.1925
Quelle/© ÖNB/Wien, Bildarchiv (Inventarnummer 204518-D) bzw. www.cyranos.ch
|
| Im darauffolgenden Jahr spielte er die Titelrolle des
Erbprinzen Hellmut alias von Hohenelb in dem nach einem
Stück von Fritz Löhner-Beda1)
realisierten Drama "Der rote Prinz"1) (1917),
gab seine Bühnenrolle, den Julius von Flottwell, im
ersten Teil der Verfilmung der Raimund-Zauberposse "Der
Verschwender"1) neben Hans Rhoden1)
als Valentin und Liane Haid als Amalie. Es folgte der Part
des Großbauern Paul Weller in dem Streifen "Im
Banne der Pflicht"1) (1917)
nach dem Drama "Hand und Herz" von Ludwig Anzengruber1),
in dem Kassenschlager "Der
König amüsiert sich"1) (1918),
auch bekannt unter dem Titel "Rigoletto", präsentierte
sich der Mime als der König – einmal mehr gehörte
Liane Haid als hübsche Tochter des Hofnarren Rigoletto (Hermann Benke)
zur Besetzung; der Film basierte auf dem Drama "Le roi
s'amuse"1) von Victor Hugo1).
Weitere Produktionen, in denen Klitsch mit Liane Haid vor der
Kamera stand waren "So
fallen die Lose des Lebens"1) (1918),
"Die
Ahnfrau"1) (1919),
"Der Herr des Lebens" (1920), "Durch Wahrheit
zum Narren" (1920) und "Die Stimme des
Gewissens" (1920). Mit der Geschichte
"Großstadtgift" (1920) beendete Klitsch seinen
überschaubaren Ausflug in die Welt des Films und konzentrierte
sich wieder auf die Arbeit am Theater → Übersicht
Stummfilme.
Wilhelm Klitsch, portraitiert von Hermann
Clemens Kosel1)
(1867–1945)
Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen
Nationalbibliothek1) (ÖNB)
Urheber: Hermann Clemens Kosel; Datierung: Unbekannt
Quelle/Rechteinhaber ÖNB/Wien, Bildarchiv;
Signatur: Pf
191 E6
|
 |
|
Ab 1927 arbeitete Klitsch zudem als Regisseur, darüber hinaus machte
er sich als Rezitator der Werke von Anton Wildgans1) und
Franz Karl Ginzkey1)
einen Namen; 1928 veröffentlichte er das Werk "Ohne Maske. Ein modernes Vortragsbuch". Seit Anfang der 1930er Jahre war er als Professor an der Wiener "Akademie für Musik und darstellende Kunst"1)
(heute "Universität für Musik und darstellende Kunst Wien")
tätig, leitete ab 1933 die neugegründete "Meisterschule für
Redekunst" (DBE). Zu seinen Schülern zählte unter anderem Harry Kalenberg1) (1921 – 1993).
|
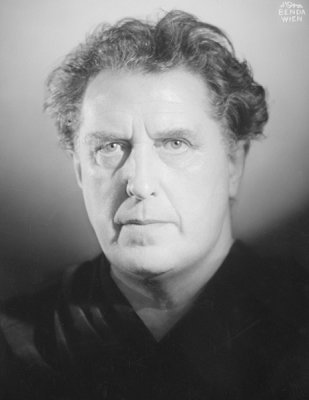 |
Professor Wilhelm Klitsch starb am 24. Februar 1941 mit nur 58 Jahren in
Wien an den Folgen eines Schlaganfalls. Die letzte Ruhe fand er auf dem dortigen
"Friedhof Hietzing"1) (Gruppe 8, Nr. 89); hier wurde später auch seine
Witwe Elfriede Klitsch (1914 – 1997) beigesetzt..
Der Künstler war nach dem Krebstod seiner ersten Frau Anna (1884 – 1929) seit Anfang der 1930er Jahre
mit seiner ehemaligen Studentin Elfriede Mayer, Tochter eines
Architekten aus Kärnten, verheiratet.2)
Aus der Verbindung ging der am 2. Mai 1934 geborene Sohn Peter Klitsch1)
hervor, der sich später einen Namen als Kunstmaler machte und zur Künstlerriege
der "Wiener
Schule des Phantastischen Realismus"1)
zählt.
Seit 1955 erinnert die "Klitschgasse" im 13. Wiener
Gemeindebezirk Hietzing1) an den
einst gefeierten Theaterschauspieler.
Porträt von Wilhelm Klitsch 1939
Foto mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen
Nationalbibliothek1) (ÖNB)
Urheber: Atelier D'Ora-Benda (Madame d'Ora1),
1881–1963); Datierung: 20.02.1939
Quelle/© ÖNB/Wien, Bildarchiv; Inventarnummer
205438-B |
|