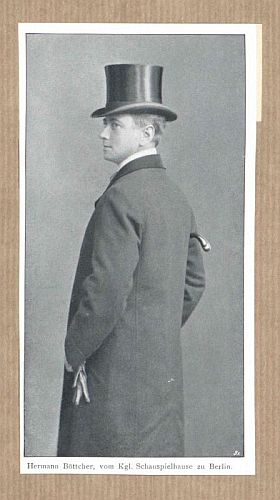|
 |
|
Der Schauspieler Hermann Böttcher erblickte am 21. November 1866 als
Hermann Gotthilf Ferdinand Boettcher und Sohn eines königlichen Regierungssekretärs
im preußischen Königsberg1) (heute:
Kaliningrad, Oblast
Kaliningrad1))
das Licht der Welt. Nach dem Besuch des "Friedrichskollegs"1)
seiner Geburtsstadt begann er nach dem Abitur ein Jurastudium an der dortigen
Universität, welches er jedoch nach einem Semester wieder abbrach.
|
Bereits als Gymnasiast hatte Böttcher den Wunsch, Schauspieler zu
werden, nun nahm er ab 1885 bei Julius Meixner2)
(1850 – 1913) dramatischen Unterricht, ab 1900
ließ er sich in Berlin unter anderem von dem italienischen Musiklehrer
und Komponisten Alfredo Cairati1) (1875 – 1960) in Gesang ausbilden.
Ein erstes Engagement erhielt Böttcher zur Spielzeit 1885/86 am
"Herzoglichen
Hoftheater"1) in Meiningen1), wo
er sich mit kleineren Rollen wie dem Diener Leonardo in dem Shakespeare-Stück "Der Kaufmann von
Venedig"1), dem böhmischer Edelmann Kosinsky in
dem Schiller-Drama
"Die Räuber"1)
oder dem jungen Cato in der Shakespeare-Tragödie "Julius Cäsar" erste
Lorbeeren erspielte. Weitere Auftritte hatte er unter anderem als ein Wanderer in
dem Schiller-Schauspiel "Wilhelm Tell"1),
als Vetter des
Waffenschmieds Teuthold in "Die
Hermannsschlacht"1) von Heinrich von Kleist1) und als Graf Teligni in "Die Bluthochzeit oder die
Bartholomäusnacht"1),
einem Trauerspiel von Albert Lindner1).
Hermann Böttcher 1905
Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
Quelle: www.cyranos.ch |
 |
|
Weitere Stationen wurden das "Stadttheater
Königsberg"1) und das
"Lobe-Theater"1) in
Breslau1), ab 1899 wirkte er in Berlin.
So trat er anfangs am "Lessingtheater"1) sowie dem
"Residenz-Theater"1) auf, im Juni 1899 gastierte er zudem am
"Königlichen Schauspielhaus"1)
in verschiedenen Stücken – so unter anderem als Leutnant Wally
in dem Lustspiel "Auf Strafurlaub" von Gustav von Moser1)
und als Prinz von Guastalla in dem Lessing-Trauerspiel "Emilia Galotti"1),
was im Jahr 1900 dort ein festes Engagement nach sich zog.
|
|
 |
Ludwig Eisenberg1)
(1858 – 1910) schreibt in seinem 1903 publizierten Lexikon*):
"Boettcher ist ein starkes Talent. Er spielt mit großer Sicherheit voll
Frische und Wärme und unbedingter Lebenswahrheit, ist von liebenswürdiger
Art, vielseitig, und stets gerne gesehen. Es gelingen ihm sowohl die
jugendlichen Liebhaber in modernen und klassischen Stücken, wie Naturburschen
und Bonvivants, wenngleich er im modernen Lustspiel mit ganz besonderem Erfolg
auftritt, wobei seine ungewöhnlich schlanke Figur es ihm ermöglicht, nach
wie vor die jugendlichsten Rollen zur besten Wirkung zu bringen, wovon sein
"Hans" in "Jugend"1)
beredtes Zeugnis gibt." Eisenberg erwähnt aus Böttchers klassischem Repertoire
besonders den junge Unterwaldner Arnold vom Melchthal in Schillers
"Wilhelm Tell" und den Bürgerssohn Brackenburg in Goethes "Egmont"1),
an zeitgenössischen Stücken bzw. Rollen werden neben dem Hans in Max Halbes1)
Drama "Jugend" vor allem die Gestaltung von jugendlichen Liebhabern
in Stücken des heiteren Sujets genannt – der Hermann in der Komödie "Jugend von heute" von Otto Ernst1),
der Leutnant Reif von Reiflingen in dem Schwank
"Reif-Reiflingen" von Gustav von Moser und der Rodrigo" in "Florio und
Flavio" mit dem Untertitel "Ein Schelmenstück und Liebesspiel in drei Akten
nach dem Spanischen" von Franz von Schönthan1)
und Franz Koppel (-Ellfeld)1).
Hermann Böttcher als Tanzmeister in der Ballettkomödie
"Der Bürger als Edelmann"1)
von Molière1)
Urheber "Zander & Labisch" (Albert Zander u. Siegmund Labisch1)
(1863–1942))
Quelle: Dieses Bild ist Teil der Porträtsammlung
Friedrich Nicolas Manskopf der
Universitätsbibliothek
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Signatur: S 36/F03095;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei) siehe hier |
Auch mit der Figur
des Leutnants Victor von Hohenegg in dem Lustspiel "Im bunten Rock"
von Franz von Schönthan und Freiherr von Schlicht1)
verbuchte Böttcher positive Kritiken, so schrieb der "Berliner
Lokal-Anzeiger" am 4. Oktober 1902 im Morgenblatt (Nr. 465) unter anderem:
"Im Schauspielhause ist gestern (Freitag) ein dreiaktiges Theaterstück:
"Im bunten Rock" mit theils verschämtem, theils sehr lautem Beifall vorgeführt worden.
Herr Böttcher war schneidig, ritterlich und liebenswürdig als siegreicher Leutnant."
Und in der Zeitschrift "Bühne und Brettl" (Hrg. Josef Jellinek, Berlin,
II. Jahrgg., Heft Nr. 19, 15.10.1902) las man "Einer der gewandtesten und elegantesten Schauspieler ist Herr Boettcher.
Sein Leutnant von Hohenegg war der Typus eines vollendeten Kavaliers in Uniform." Die
"Neue Preußische Zeitung"1) (Nr. 466, 04.10.1902) meinte "Herr Boettcher spielte den Husarenleutnant ebenfalls
mit großer Verve und vereinigte aufs
glücklichste jugendlichen Leichtsinn, leidenschaftliches Empfinden und chevalereskes Auftreten.
Es ist eine sehr gefährliche Rolle, in der unsere meisten Bonvivants zu schneidig sein dürften."
(Quelle sowie mehr bei www.karlheinz-everts.de)
Bis 1922 blieb Böttcher dem "Königlichen Schauspielhaus" bzw. dem
"Preußischen Staatstheater" treu, anschließend gastierte er vielfach als Charakterkomiker, unter anderem mehrfach in
Sankt Petersburg1).
Zudem machte sich auch als Lautensänger und Rezitator einen Namen, arbeitete frühzeitig für den Funk
sowie für den Film. Bereits 1915 gab er sein Leinwanddebüt als
Detektiv in dem dem von Harry Piel
mit Traute Carlsen1) in
Szene gesetzten Streifen "Manya, die Türkin"1), ab Ende der
1910er Jahre intensivierte der Schauspieler seine Arbeit für das immer
beliebter werdende neue Medium Film. Der Schauspieler übernahm meist
prägnante Nebenrollen und mimte oft hochgestellte Persönlichkeiten
wie als Joseph Fouché1), Mitglied des Konvents und späterer
Polizeiminister, in dem Historienfilm "Madame Récamier"1) (1920)
mit Fern Andra als die "Madame Récamier"1) genannte
Salonnière Juliette Récamier und Bernd Aldor als Schauspieler François-Joseph Talma1), aber auch Kammerherren wie in Georg Jacobys1) Melodram "Das Schwabemädle"1) (1918)
mit Ossi Oswalda in der Titelrolle.
Als Lord Pombroke zeigte
er sich neben Lil Dagover und
Conrad Veidt in
dem Abenteuer "Das Geheimnis von
Bombay"1) (1921), Fritz Lang1) betraute ihn mit der Rolle des Vaters
der Florence Yquem (Carola Toelle)
in seinem prominent besetzten, lange als verschollen angesehenen frühen Drama "Vier
um die Frau"1) (1921; auch "Kämpfende Herzen"),
in der von Friedrich Zelnik
mit Ehefrau Lya Mara in einer Doppelrolle inszenierten Geschichte "Auf
Befehl der Pompadour"1) (1924) war er
ebenfalls als Vater zu sehen, diesmal
von der jungen, dynamischen Lucienne (Mara), die, obwohl sie den Chefingenieur
(Alphons Fryland) der
Autofabrikation ihres Onkels Abel Fernay (Alwin Neuß) liebt, zu der Ehe mit
einem ungeliebten Mann, einem adeligen Großunternehmer, gezwungen werden
soll.
Hermann Böttcher, vom "Kgl. Schauspielhaus" zu Berlin
Foto mit freundlicher Genehmigung der
Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)1)
Urheber/Autor: Unbekannt; Recteeinhaber ÖNB/Wien
Bildarchiv Austria (Inventarnummer PORT_00146820_01)
|
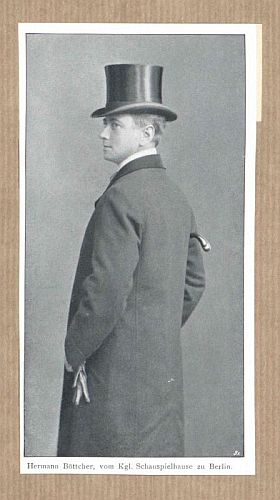
|
In der dritten Produktion der "Fridericus-Rex-Filme"1)
um die Person des von Otto Gebühr
dargestellten Preußenkönigs Friedrich II.1)mit
dem Titel "Die
Mühle von Sanssouci"1) (1926) tauchte
Böttcher als Juwelier Lustig, Vater von Henriette (Hanni Weisse) auf – 1928 sollte er im 1. Teil von
"Der
alte Fritz"1)
als Minister Brenckenhof zu sehen sein. Den Oberhofmeister Graf Leoben gab er in Friedrich Zelniks
Adaption "Die Försterchristel" (1926) nach der gleichnamigen
Operette1) von Georg Jarno1) (Musik)
und Bernhard Buchbinder1) (Libretti) einmal mehr neben Titelheldin Lya Mara, den
alten Fürsten in der ganz auf Carmen Boni
zugeschnittenen amüsanten Geschichte "Prinzessin Olala"1) (1928),
gedreht von Robert Land1)
nach Motiven der gleichnamigen Operette von Jean Gilbert1) (Musik)
und Rudolf Bernauer1) (Libretti);. Zu seinen
letzten Arbeiten für den Stummfilm zählten kleinere
Parts in Lupu Picks Historienstreifen "Napoleon
auf St. Helena"1) (1929) mit Werner Krauß als Napoleon Bonaparte1) und in
dem von Willi Wolff1) mit
Ehefrau Ellen Richter realisierten Abenteuer/-Kriminalfilm "Polizeispionin 77"1) (1930)
nach dem Roman "Der Ruf der Tiefe" von Max Uebelhör1) → Übersicht
Stummfilme.
Im Tonfilm war der inzwischen über 60-jährige Böttcher nur noch wenige Male
auf der Leinwand präsent und trat unter anderem als General von Rastenfeld in
Jaap Speyers1) Operettenfilm "Zapfenstreich
am Rhein" (1930) auf. Seine letzte Arbeit vor der Kamera
war unter der Regie Friedrich Zelnik die Verkörperung des österreichischen Ministers Graf Kaunitz1) in dem
inzwischen sechsten, mit Otto Gebühr realisierten "Fridericus-Rex-Film""Die
Tänzerin von Sanssouci"1) (1932) mit
Lil Dagover als
Barberina Campanini1), die Tänzerin von Sanssouci. Die Uraufführung erfolgte
am 8. September 1932 in Stuttgart und Dresden, in Berlin konnte man den Film
erstmals am 16. September 1932 im "Ufa-Palast am Zoo"1)
sehen → Übersicht Tonfilme.
Nur etwas mehr als zweieinhalb Jahre später starb der Theater- und Filmschauspieler Hermann Böttcher am 27. Mai 1935 im Alter von 68 Jahren im ehemals
mecklenburgischen Fürstenberg/Havel1) (heute Bundesland Brandenburg); über
sein Privatleben ist nichts bekannt.
|
|
|

|
Quellen (unter anderem*)):
Wikipedia,
cyranos.ch
sowie
Volker Wachter1)
|
*) Ludwig Eisenberg:
"Großes
biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert" (Verlag
von Paul List, Leipzig 1903);
Digitalisiert: Hermann Böttcher: S. 108,
109
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) geschichtewiki.wien.gv.at
Lizenz/Genehmigung Foto Hermann Böttcher (Urheber
unbekannt): Dieses Werk ist älter als 70 Jahre und sein Erschaffer nicht
bekannt. Nach der Berner Konvention und den Gesetzen vieler Länder gilt
dieses Werk als gemeinfrei.
Lizenz Foto Hermann Böttcher (Urheber
"Fotoatelier Zander & Labisch", Berlin): Das Atelier
von Albert Zander und Siegmund
Labisch († 1942) war 1895 gegründet worden; die inaktive
Firma wurde 1939 aus dem Handelsregister gelöscht. Externe Recherche
ergab: Labisch wird ab 1938 nicht mehr in den amtlichen
Einwohnerverzeichnissen aufgeführt, so dass sein Tod angenommen werden
muss; Zander wiederum war laut Aktenlage ab 1899 nicht mehr aktiv am
Atelier beteiligt und kommt somit nicht als Urheber dieses Fotos in Frage.
Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von
dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen
und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.
(Quelle: Wikipedia)
|

|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database
sowie filmportal.de
(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, cyranos.ch; R = Regie)
|
Stummfilme
- 1915: Manya, die Türkin
(R/Drehbuch: Harry
Piel; als der Detektiv; Traute
Carlsen als Manya)
- 1918: Der Mann der Tat
(R: Victor
Janson; mit Emil
Jannings; als ?) → Murnau Stiftung
- 1919: Das Schwabemädle
(R: Georg
Jacoby; mit Ossi
Oswalda in der Titelrolle; als Kammerherr)
- 1919: Das Gerücht (R: Adolf
Gärtner; als Professor) → Early Cinema Database
- 1920: Das große Licht
(nach dem Bühnenstück von Felix Philippi;
R: Hanna Henning; als Prof. Marquard,
Lehrer an der Kunstakademie; mit Emil
Jannings als Lorenz Ferleitner, Baumeister des Münsters)
- 1920: Madame Récamier. Des großen Talma letzte Liebe
(R: Joseph
Delmont; mit Fern
Andra als Juliette Récamier,
genannt "Madame
Récamier", Bernd
Aldor als Schauspieler François-Joseph
Talma; als Joseph Fouché,
Mitglied des Konvents und späterer Polizeiminister)
- 1920: Die Insel der Gezeichneten (R: Joseph Delmont; als ?) → IMDb
- 1921: Das Geheimnis von Bombay. Das Abenteuer einer Nacht
(R: Artur Holz;
mit Lil
Dagover und Conrad
Veidt
in den Hauptrollen; als Lord Pombroke) → filmportal.de,
Murnau Stiftung
- 1921: Vier
um die Frau / Kämpfende Herzen (nach dem Bühnenstück
"Florence oder Die Drei bei der Frau" von
Rolf E. Vanloo;
R: Fritz
Lang (auch Drehbuch mit Thea
von Harbou); als Vater von Florence Yquem (Caola
Toelle),
der Ehefrau von Makler Harry Yquem (Ludwig
Hartau)) → filmportal.de
- 1921: Treibende Kraft
(nach einer Vorlage von Victorien
Sardou; R: Zoltán Nagy; mit Fern
Andra; als ?) → IMDb
- 1921: Das Handicap der Liebe
("Joe
Deebs"-Detektivreihe mit Ferdinand
von Alten als Joe Deebs; R: Martin
Hartwig;
als Morris Harryman)
- 1921: Baron Bunnys Erlebnisse, 1. Teil: Der Meisterdieb (nach dem Roman von Th. Offenstetten; R: Ernst
Fiedler-Spies
als ?) →
IMDb
- 1922: Die Heimkehr des Odysseus (R: Max
Obal; mit Luciano
Albertini; als ?) → IMDb
- 1922: Aus den Erinnerungen eines Frauenarztes (R: Gerhard
Lamprecht, Lupu Pick
(auch Darsteller); als ?)
- 1. Fliehende Schatten> → IMDb
- 2. Lüge und Wahrheit → IMDb
- 1922: Bigamie (nach dem Drama "Der lebende
Leichnam" von Leo
Tolstoi; R: Rudolf
Walther-Fein;
m,it Alfred
Abel als Fedja; als ?) → IMDb;
siehe auch Verfilmung 1929
sowie projekt-gutenberg.org
- 1922: Das Mädchen aus dem goldenen Westen
(R: Hans
Werckmeister; mit Maria
Zelenka in der Titelrolle; als ?)
- 1923: Madame Golvery (R: Václav Binovec (1892–1976); mit Suzanne Marwille (1895–1962) als Zina Golveryová; als ?)
→ IMDb
- 1923: Die Gasse der Liebe und der Sünde
(R: Jan Svoboda (1889–1974), Václav Binovec (1892–1976); als Schriftsteller Jensen)
- 1924: Die Herrin von Monbijou
(R: Friedrich
Zelnik; mit Ehefrau Lya
Mara in der Titelrolle; als ?)
- 1924: Das Mädel von Capri
(R: Friedrich Zelnik mit Ehefrau Lya Mara in der Titelrolle; als
Vater des
Grafen Montebello (Ulrich
Bettac) (Zuordnung unsicher))
- 1924: Auf
Befehl der Pompadour (R: Friedrich Zelnik; mit Ehefrau Lya
Mara in deer Doppelrolle der Lucienne und
der Marquise
de Pompadour; als Vater von Lucienne)
- 1924: Das Mädel von Pontecuculi
(R: Ludwig Czerny;
mit Ada Svedin in der Titelrolle; als Hofmarschall
Graf Dodo Caramba Formanoli)
- 1925: Die Anne-Liese von Dessau (R: James
Bauer; mit Maly
Delschaft als Anna Luise, Werner
Pittschau als
Leopold von Anhalt Dessau; Kurzinfo: Obwohl Fürstin
Henriette
Catharina von Nassau-Oranien (1637–1708) –
die Mutter (Julia Serda)
von Prinz Leopold I. von Anhalt-Dessau – und Rudolf Föhse
(1646–1693) – der Vater von
Anna Luise Föhse
(1677–1745) und Apotheker des Hofes
von Dessau (Hermann Böttcher ?) – dagegen sind,
wird Anna Luise 1698 die Frau von Leopold I.
(1676–1747), später genannt
"Der alte Dessauer" (Pittschau).
Er entwickelt
sich zum ersten großen Reformator der preußischen Armee und einem
der
beliebtesten Armee-Generäle.
Anna-Luise, die ihm zehn Kinder
schenkt, bietet mit ihrem interessanten Charakter Stoff für
mehrere Theaterstücke.
Dank an Dr. Heinz
P. Adamek für die Information → IMDb
- 1926: Die
Mühle von Sanssouci (Fridericus-Rex-Film;
mit Otto Gebühr als Preußenkönig Friedrich
der Große;
R: Siegfried
Philippi; als Juwelier Lustig, Vater von Henriette (Hanni
Weisse))→ filmportal.de
- 1926: Die Försterchristel
(nach der gleichnamigen Operette von Georg
Jarno (Musik) und Bernhard
Buchbinder (Libretti);
R: Friedrich
Zelnik; mit Ehefrau Lya
Mara in der Titelrolle; als Oberhofmeister Graf von Leoben)
- 1926: Gräfin Plättmamsell
(R: Constantin
J. David; mit Ossi
Oswalda in der Titelrolle und Curt
Bois in der männlichen
Hauptrolle; als ?)
- 1928: Der
alte Fritz (2 Teile; Fridericus-Rex-Film; mit Otto Gebühr als Preußenkönig Friedrich
der Große;
R: Gerhard
Lamprecht)
- 1928: Prinzessin Olala
(nach Motiven der gleichnamigen Operette von Jean
Gilbert (Musik) und Rudolf
Bernauer (Libretti);
R: Robert
Land; mit Carmen
Boni; als der alte Fürst) → marlenedietrich-filme.de
- 1928: Unmoral
(R: Willi Wolff;
mit dessen Ehefrau Ellen
Richter; als ?)
- 1929: Mein Herz ist eine Jazzband
(R: Friedrich
Zelnik; als Stanfield)
- 1929: Die Mitternachts-Taxe
(von (Regie) und mit Harry
Piel; als Kommissar Tenner)
- 1929: Napoleon
auf St. Helena / Der gefangene Kaiser (R: Lupu
Pick; mit Werner
Krauß als Napoleon
Bonaparte; als ?)
→ filmportal.de
- 1930: Polizeispionin 77
(nach dem Roman "Der Ruf der Tiefe" von Max
Uebelhör; R: Willi Wolff;
mit dessen Ehefrau
Ellen
Richter als Florida, die Polizeispionin 77; als ?)
Tonfilme
|
|

|