
|
Ellen Richter wurde am 21. Juli 1891 als Käthe Weiß in
Wien1)
geboren. Ihre Eltern bzw. Vorfahren stammte aus Ungarn und waren
jüdischen Glaubens, Tochter Käthe das jüngste von fünf
Kindern des Schneidermeisters Jakob Weiß und dessen Ehefrau Rosa.
Sie besuchte eine Volksschule, anschließend ließ sich das junge
Mädchen an der
"k.u.k. Akademie
für Musik und darstellende Kunst"1) von
dessen damaligen Leiter (1901–1910), Ferdinand Gregori1)
(1870 – 1928), zur Schauspielerin ausbilden. Die
Prüfung legte sie mit Auszeichnung ab, ein erstes Engagement
erhielt Ellen Richter, wie sie sich nun mit Künstlernamen nannte,
1908 am "Stadttheater
Brünn"1) im heutigen Brno1) (Tschechien) . Weitere
Verpflichtungen führten sie nach Wien an die "Residenzbühne" (1910;
heute "Wiener Kammerspiele"1)),
an die "Künstlerbühne" (1911) nach München1) sowie
an das Berliner "Theater
am Nollendorfplatz"1) (1912), wo sie unter anderem als
Orestes in der Operette "Die schöne Helena"1)
von Jacques Offenbach1) glänzte.
Anfang/Mitte der 10er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wandte sich Ellen Richter
dem noch jungen Medium Film zu und stand erstmals für den
stummen Streifen "Rechte des Herzens" (1913)
zusammen mit Paul Otto vor der Kamera.
Foto: Ellen Richter 1928
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: Wikipedia;
Ross-Karte Nr. 3360/2 (Ausschnitt)
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
| Nach dem
Melodram "Der Eremit" (1915) und der Rolle einer berühmten Sängerin
an der Seite von Titelheld Aurel Nowotny1) war sie in dem
Krimi "Das Gesetz der Mine"1) (1915)
aus der "Joe
Deebs"-Reihe1) neben Max Landa die weibliche Hauptdarstellerin, weitere stumme
Melodramen und vor allem Abenteuer schlossen sich mit Ellen Richter
als Protagonistin in rascher Folge an, die Mimin avancierte zur
populären Stummfilm-Diva. Vor allen unter der Regie von Richard Eichberg1) bzw. bei dessen
Produktionsfirma entstanden eine Reihe von stummen Streifen, in
denen Ellen Richter mit Hauptrollen, meist Frauen der Gesellschaft
glänzen konnte. So zeigte sie sich beispielsweise als Carmen Sorgatha, die spätere Fürstin Metschersky, in "Das
Tagebuch Collins"1) (1915)
mit Walter Steinbeck als Partner, als
die junge Cora Gabor, Tochter der Wäscherin
Frau Gabor (Anna von Palen1)) bzw. später Gattin des Grafen Carlo Moretti (Karl Falkenberg1)) in dem Drama
"Das
Skelett"1) (1916), als
Abenteurerin Fürstin Carmen Metschersky in der ebenfalls
dramatischen Geschichte "Leben
um Leben"1) (1916), als
Prokuristentochter Lisbeth Wollnau, später Gattin des Großkaufmanns
Robert Erle (Kurt Brenkendorf
oder Reinhold Pasch) in dem
Krimi-Drama "Frauen,
die sich opfern"1) (1916)
oder als Margot, Tochter von Prof. Duyssen (Georg Leux) und dessen
Gemahlin Anna (Marga Köhler1)), bzw. Braut und
Ex-Frau des Hans van Bergen (Hans Mierendorff) in der tragisch endenden
Story "Der
Ring des Schicksals"1) (1916).
Foto: Ellen Richter vor 1929
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: www.cyranos.ch;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
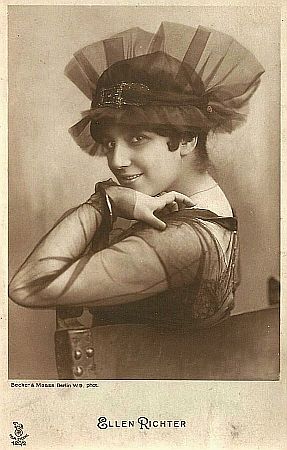 |
Man sah Ellen Richter als
Katharina Karaschkin, später
Werra Ossip, eine polnische Nationalsängerin, in dem
Stummfilm "Katharina Karaschkin"1) (1917) mit
dem Untertitel "Märtyrer der Liebe" und die "Neue
Kino-Rundschau" (20.10.1917) urteilte "… ein vorzügliches Drama, mit Ellen Richter in der
Hauptrolle… Die hervorragende Darstellungskunst der beliebten
Schauspielerin, das tadellose Zusammenspiel mit ihren Partnern und
nicht zuletzt die spannende, logisch aufgebaute Handlung fesselten
unsere Aufmerksamkeit vom erste bis zum letzten Augenblick der Vorführung.
Auch die eingeschobenen Ballettszenen im 2. Akt, ein meisterhaft
ausgeführter kleinrussischer Nationaltanz, und ein allegorisches
Bild, das Spiel des Fauns mit den Nymphen darstellend, verdienen
lebhaften Beifall." → anno.onb.ac.at
Weitere
von Eichberg in Szene gesetzte Melodramen waren unter anderem "Das
Bacchanal des Todes"1) (1917) mit ihrem
Part der
Lona, Tochter des Gastwirts Antonio Sarto
(Victor Janson), und Modell
des Malers Alexander Andrea (Erich Kaiser-Titz), "Für
die Ehre des Vaters"1) (1917), wo sie als Tessa, Tochter des Fabrikanten Flemming (Andreas von Horn1)) sowie
Verlobte des Chemikers Alfred Delmer (Bruno Kastner)
auftrat,
oder "Und
führe uns nicht in Versuchung"1) (1917)
mit Theodor Loos
als Laienbruder Franziskus, später Bildhauer und Ehemann
von Maritana (Ellen Richter).
Ellen Richter ca. 1920 auf einer Künstlerkarte,
aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass",
Berlin
(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))
Quelle: Wikimedia
Commons; ("Film Sterne"-Serie Nr. 120/2)
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
|
Am 19. Juni 19153)
hatte Ellen Richter den promovierten (Dr. med. dent.,
Dr. phil.) Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzenten Willi Wolff1)
(1883 – 1947) geheiratet, nach Ende des 1. Weltkrieges
bildete das Paar auch beruflich ein Gespann. Ehemann Wolff fungierte anfangs als
Drehbuchautor wie bei dem von Rudolf Meinert1) gedrehten Historiendrama
"Das
Spielzeug der Zarin"1) ( 1919),
der von Rudolf Biebrach frei auf dem Roman "Marion Delorme" von Victor Hugo1) realisierten
Adaption "Der
rote Henker"1) (1920) oder
"Brigantenliebe"1) (1920;
Regie: Martin Hartwig1)) mit Ellen Richter
als rassig-temperamentvolle Fiametta und Hans Adalbert Schlettow als Brigant1)
(Räuberhauptmann) Carlo. 1920 gründete beide die Produktionsfirma "Ellen Richter Film GmbH",
nach Wolffs Drehbüchern und unter der Regie von
Adolf Gärtner1) entstanden Kassenschlager wie unter anderem der Zweiteiler
"Napoleon
und die kleine Wäscherin"1) (1920)
frei nach dem Lustspiel "Madame Sans-Gêne" von Victorien Sardou1) mit
Richter als Catherine Lefèbvre"1), genannt "Madame Sans-Gêne"
und Rudolf Lettinger als französischer
Kaiser Napoleon Bonaparte1),
das Drama "Die
Fürstin Woronzoff"1) (1920),
der Dreiteiler "Die Abenteuerin von Monte Carlo" (1921, → filmuniversitaet.de)
oder der Streifen "Das
Rätsel der Sphinx"2) (1921).
Hans Adalbert von Schlettow als Brigant Carlo und Ellen Richter
als Fiametta in dem Stummfilm "Brigantenliebe" (1920)
Quelle: Deutsche Fotothek, (file: df_pos-2006-a_0000866) aus
"Vom Werden deutscher Filmkunst/1. Teil: Der stumme Film" von
Dr. Oskar Kalbus1)
(Berlin 1935, S. 27) bzw. Ross-Verlag 1935;
©SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf;
Quelle: www.deutschefotothek.de;
Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017
|
 |
 |
Ab 1922 übernahm Wolff nach eigenen Drehbüchern (mitunter als Co-Autor)
dann selbst die Regie bei den Stummfilmen, in denen seine Ehefrau stets im Mittelpunkt
stand und er diese kontinuierlich zu einem weiblichen Harry Piel (1892 – 1963)
aufbaute. Seine Filme
waren künstlerisch gänzlich bedeutungslos, jedoch spannende und
recht kurzweilige Abenteuer- und Sensationsgeschichten mit exotischen Spielorten und einigen sportiven Einlagen.4).
Das Publikum erlebte Ellen Richter beispielsweise als Titelheldin als Lola Montez1)
in "Lola Montez, die Tänzerin des Königs"1) (1922)
neben Arnold Korff als Bayernkönig Ludwig I.1),
als "Die Frau mit den Millionen" in dem gleichnamigen
Dreiteiler, als wagemutige Eleonore "Ellinor' Rix" in dem zweiteiligen
Abenteuer "Der
Flug um den Erdball"1) (1925),
als "Die tolle Herzogin"1) (1926) oder
als die vornehme "Dame mit dem Tigerfell" Ellen Garat alias Gräfin Perpignan in der heiteren
Geschichte "Die Dame mit dem Tigerfell"2) (1927).
In dem Revuefilm "Die
schönsten Beine von Berlin" (1927) musste sie sich als
Tänzerin Dolores gegen ihre Konkurrentin Poupette (Dina Gralla) durchsetzen,
in "Kopf
hoch, Charly!"1) (1927), gedreht
nach einem in der "Berliner
Illustrirte Zeitung"1)
erschienenen Roman von Ludwig Wolff1), war Ellen Richter die von
allen nur "Charly" genannte brünette Charlotte Ditmar, in deren
Leben einiges schief läuft.
Foto: Ellen Richter vor 1929
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: www.virtual-history.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
|
Allerdings waren die Reaktionen nicht ganz so
positiv, so meinte der Filmkritiker Kurt Mühsam1) unter anderem in der Berliner "B.Z. am Mittag"1) (50. Jahrgang, Nr. 76 vom 19.03.1927) unter andrem: "Das Vielerlei an spannenden Begebenheiten, das dieser Film bringt, fesselt das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene. Wohl ist manche der Feinheiten, die der seinerzeit in der"Berliner Illustrierten Zeitung" erschienene Roman von Ludwig Wolff in sich trug, durch die Manuskriptverfasser Willi Wolff und
Robert Liebmann1) über
Bord geworfen worden, um den Stoff den Gesetzen der Filmdramaturgie anzupassen, doch ist noch genug
des Schmackhaften übriggeblieben, um den Erfolg des Films zu sichern. (…) Willi Wolff, der Regisseur,
hat allen Szenenbildern den Zauber der Echtheit abgewonnen, schade nur, daß die Hauptdarstellerin nicht
in gleicher Weise den Anforderungen ihrer Rolle gerecht wird. Wohl muß man anerkennen, daß Ellen Richter
mit bewunderungswürdiger Selbstverleugnung zuließ, daß ihre Gegenspielerin Margerie Quimby durch ihren
besonderen Charme und ihr sicheres Spiel sie selbst so sehr in den Schatten stellen durfte. Aber
Ellen Richters Mimik war diesmal blasser denn je, ihr Spiel manieriert und ihr Aussehen trotz der
prächtigen Roben, die sie trug, nicht so, daß ihre Rolle unbedingt glaubhaft wurde.
Anton Pointner war
dagegen der stets sympathische junge Ehemann, dem man sein Glück an der Seite der schönen Dollarmillionärin gerne gönnte."
Foto: Ellen Richter vor 1929
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: www.virtual-history.com;
Ross-Karte Nr. 1768/2
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
Und im "Berliner
Börsen-Courier"1) (59. Jahrgang, Nr. 133 vom 20.03.1927) konnte man
lesen "Es ist ein deutsch-amerikanischer Gemeinschaftsfilm. Die amerikanische Photographie erschlägt die deutsche.
Weniger durch Stimmungsmalerei als durch interessante Kamera-Einstellung. Der junge Deutsche erblickt das Hotel,
sein Blick wandert die Wolkenkratzerwand hinauf. Er verbiegt sich fast das Genick. Prachtvolle
Stadtbilder von New York. Schade, daß sich der Film, wie der spannende Roman von Ludwig Wolff, in
Hochstapler- und Spielerklischees verliert. Ellen Richter wird schwer tragisch, während
Michael Bohnen
zuweilen durch leichte Bonvivantzüge angenehm überrascht."

|
Bis zum Ende der Stummfilm-Ära trat Ellen Ellen Richter unter anderem noch
in dem Lustspiel "Moral"1) (1928) nach der
gleichnamigen Vorlage von Ludwig Thoma1) auf und mimte als Ninon de Hauteville die Chefin
der Revuetruppe, die von den alteingesessenen
Honoratioren und Mitgliedern eines Sittlichkeitsvereins unter der Führung
von Rentier Beermann (Jakob Tiedtke) als Gefährdung des sittlichen
Anstands der Dorfgemeinschaft
"verdammt" wird. In dem kriminalistischen Abenteuer "Die
Frau ohne Nerven"1) (1930)
entsprach sie als Sensationsreporterin Ellen Seefeldt zwar einmal mehr
ihrem Image, doch waren die Kritiker hier wenig überzeugt: Beispielsweise
befand Hans Sahl1) im "Berliner Börsen-Courier"
(Ausgabe Nr. 31 vom 19.01.1930), dass
die Handlung ein "unwahrscheinliches Durcheinander" offenbare,
das nicht nur eine Frau ohne Nerven benötige, sondern auch ein
ebensolches Kinopublikum. Fazit: "Ellen Richter als Harry Piel. Die
Regie von Willi Wolff bewegt sich in dem herkömmlichen Rahmen gängiger
Unterhaltungsstaffage." Und In der "B.Z. am Mittag" war zu lesen, dass Ellen Richter
offensichtlich den Anschluss an die Kinomoderne verpasst habe:
"Sie hat früher in großer Zahl die netten, spannenden Abenteurer- und Reisefilme gedreht,
und es ist ihr oder ihres Autor-Regisseur-Gatten Willi Wolff Irrtum, dieses genau gleiche
Genre heute für genau gleich nett und spannend zu halten. (…) Nicht nur die Amerikaner,
auch wir packen solche Sujets längst ganz anders an. Die Ausführung hat Tempo und Witz,
aber Wolff hat schon mit mehr Verve und minus Regieschnitzer, Ellen Richter ohne so aufgeregte
Übertriebenheit, der Fotoverantwortliche mit größerer Akkuratesse gearbeitet."
(Quelle: Wikipedia)
Foto: Ellen Richter vor 1929
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle:
www.virtual-history.com;
Ross-Karte Nr. 1768/2
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
Ellen Richters Star-Ruhm neigte sich somit offensichtlich dem Ende
entgegen, ihr letzter Stummfilm war der am 14. März 1930 uraufgeführte
Abenteuer- und Kriminalstreifen "Polizeispionin 77"1) nach dem Roman "Der
Ruf der Tiefe" von Max Uebelhör1), wo
sie als Florida die titelgebende Polizeispionin 77 darstellte. Auch
hier waren die Kritiken eher negativ, Georg Herzberg befand 1930
im "Film-Kurier"1):
"Wieder einmal muß das Pariser Apachenleben als Milieu für einen Kriminalfilm dienen. (…)
Ladislaus Vajda1)
und Willi Wolff, die als Autoren zeichnen, haben aus diesen vielen aufregenden Zutaten einen keineswegs
aufregenden Film gemacht. Und auch die Regie Willi Wolffs ist phantasielos, zu schwerfällig und
hausbacken, um den Zuschauer in den Bann der Ereignisse zu ziehen. Als Aktivum sind ein paar
Kaschemmenbilder zu buchen, von den Darstellern gefallen die wandlungsfähige Ellen Richter, eine
ausgezeichnete Verbrecher-Type Ralph Arthur Roberts und
Karl Huszar in der Rolle eines zweifelhaften Wirtes."
(Quelle: Wikipedia) → Übersicht
Stummfilme
Ellen Richter auf einer Künstlerkarte ("Film Sterne"-Serie Nr.
120/5),
aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass",
Berlin
(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))
Quelle: www.virtual-history.com;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
Die so genannte "Machtergreifung"1) der
Nationalsozialisten
Ende Januar 1933 beendete abrupt sowohl Ellen Richters Karriere als
auch die ihres Ehemannes. Bereits 1933 wurde die Jüdin Ellen Richter mit
einem Spielverbot belegt und 1938 aus der Reichsfilmkammer1)
ausgeschlossen. Willi Wolff konnte zwar noch bis 1934 für den Film
weiterarbeiten, zuletzt als Produzent für seine eigene Firma "Riton-Film".
Nach einer Zwangs-Auflösung der "Riton-Film, ließ sich das Paar
1935 in Wien nieder, Wolff arbeitete als Zahnarzt, außerdem gründete er in der
österreichischen Hauptstadt eine Aktiengesellschaft, die sich auf die Herstellung
von Zahnprothesen spezialisierte. Ellen Richter arbeitete in dieser Firma als Prokuristin.4)
Nach dem "Anschluss Österreichs"1) an das Deutsche
Reich bzw. der De-facto-Annexion am 12. März 1938 gingen beide
zunächst in die Tschechoslowakei1),
emigrierten anschließend nach Paris, wo Wolff erneut eine Zahnarzt-Praxis betrieb.
Während des 2. Weltkrieges gelang es dem Ehepaar wenige Monate nach dem
Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich1) bzw. der Besetzung von Paris (08.06.1940) erneut zu fliehen,
über Lissabon1)
(Portugal) kamen sie am 3. Dezember 1940
in den USA bzw. New York City1) an.
Willi Wolff nahm dort wieder ein Studium auf, um auch den US-amerikanischen
Doktorgrad zu erwerben, als Künstler bzw. für den Film traten beide
nicht mehr in Erscheinung. Richters Mutter und ihre älteren Schwestern
wurden von den Nazis in deutschen Konzentrationslagern ermordet.
Nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes – Willi Wolff1) starb am 6. April 1947
mit nur 63 Jahren während
einer gemeinsamen Europa-Reise in einem Hotel in Nizza1) an
den Folgen eines Herzinfarktes – lebte Ellen Richter, die seit Mai 1946 die
amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, noch mehrere Jahre in New York
bzw. im Westen Hollywoods1).
Wikipedia
(Stand: August 2023) hingegen vermerkt, sie sei bereits im April 1947 nach
Berlin zurückgekehrt, wo sie ihre alte Firma, die "Ellen Richter Film GmbH" neu gründete. 1952 habe
sie in Baden-Baden1) auch die "Riton-Film GmbH" zu neuem Leben erweckt.
Später zog sie nach Düsseldorf1), da
dort ein Neffe ihres verstorbenen Mannes lebte. Ellen Richter starb dort
am 11. September 1969 im Alter von 78 Jahren. Auf eigenen Wunsch fand sie
die letzte Ruhe auf dem Friedhof in Nizza an der Seite ihres
Ehemannes.
Bei filmportal.de
kann man lesen: "Trotz ihrer damaligen Popularität und einer Filmografie von über 70 Filmen gehörte Ellen Richter
lange Zeit zu den vielen von der Filmgeschichtsforschung marginalisierten und damit vergessenen Frauen, die in den
frühen Jahren dem Kino in allen Gewerken maßgeblich Form und Ausdruck gaben. Von den Filmen, in denen sie
mitwirkte oder die von ihrer Produktionsfirma realisiert wurden, sind bis heute nur ein Bruchteil überliefert. Erst
mit dem wachsenden Interesse an der Rolle von Frauen in der Filmgeschichte und durch konkrete
Impulse einer feministisch geprägten Filmwissenschaft wurden in den 2010er Jahren mehrere ihrer Filme
in Filmarchiven entdeckt und restauriert. Im Sommer 2019 widmeten ihr das
"Deutsche Historische Museum Berlin"1)
und die "Filmuniversität Babelsberg"1) den internationalen Workshop
"Die große Unbekannte – Ellen Richter
und das populäre Kino in Deutschland 1913–1933", in dessen Rahmen auch eine umfangreiche
Retrospektive ihrer Filme gezeigt wurde." → filmuniversitaet.de
Foto: Ellen Richter 1928
Urheber: Alexander Binder1) (1888 – 1929)
Quelle: Wikimedia
Commons
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
|
|
|
Stummfilme (Auszug; als Darstellerin)
- 1913: Rechte des Herzens
(R: ?; als Gerda Larsen, Paul
Otto als Arzt Alfred Keller) → Early Cinema Database
- 1915: Der Eremit
(R: Franz
Hofer; mit Aurel
Nowotny in der Titelrolle; als die Sängerin)
- 1915: Das Gesetz der Mine
("Joe
Deebs"-Detektivreihe mit Max
Landa als Joe Deebs; R: Joe
May; als ?)
- 1915: Schlemihl.
Ein Lebensbild (R: Richard
Oswald; mit Rudolph
Schildkraut als Schlemihl, altes Faktotum des
von Guido
Herzfeld dargestellrn Trödlers Ehrenstein; Joseph
Schildkraut als Schlemihls Sohn Jakob; als Lea,
Ehrensteins Tochter und Schwester von Moritz (Lupu
Pick); Film gilt als verschollen) → filmportal.de
- 1915–1921: Filme unter der Regie von Richard
Eichberg
- 1915: Das Tagebuch Collins
(mit Walter
Steinbeck als Ingenieur Fred Collin; als Carmen Sorgatha,
die spätere Fürstin Metschersky)
- 1916: Das Skelett
(als die junge Cora Gabor, Tochter der Wäscherin Frau
Gabor (Anna
von Palen),
später Gattin des Grafen Carlo Moretti (Karl
Falkenberg))
- 1916: Leben um Leben
(als Abenteurerin Fürstin Carmen
Metschersky) → filmportal.de
- 1916: Frauen, die sich opfern
(als Prokuristentochter Lisbeth Wollnau, später Gattin des Großkaufmanns
Robert Erle (Kurt
Brenkendorf oder Reinhold
Pasch) → filmportal.de (Foto)
- 1916: Der Ring des Schicksals
(als Margot, Tochter von Prof. Duyssen (Georg
Leux) und dessen Gattin
Anna (Marga
Köhler)) → filmportal.de (Foto)
- 1917: Die im Schatten leben / Schuldlos Geächtete (als Hanna Mertens)
→ IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Katharina Karaschkin.
Märtyrer der Liebe (als Katharina Karaschkin, später Werra
Ossip,
eine polnische Nationalsängerin)
- 1917: Das Bacchanal des Todes
(als Lona, Tochter des Gastwirts Antonio Sarto (Victor
Janson) und
Modell des Malers Alexander Andrea (Erich
Kaiser-Titz)) → filmportal.de (Foto)
- 1917: Für die Ehre des Vaters
(als Tessa, Tochter des Fabrikanten Flemming (Andreas
von Horn) sowie
Verlobte des Chemikers Alfred Delmer (Bruno
Kastner)) → filmportal.de (Foto)
- 1917: Und führe uns nicht in Versuchung
(als Maritana, das Modell; Theodor
Loos als Laienbruder Franziskus,
später Bildhauer und Maritanas Ehemann) → filmportal.de (Foto)
- 1918: Strandgut oder Die Rache des Meeres
(als Ihne, Pflegetochter des des Fischers Jensen)
- 1918: Die Flucht des Arno Jessen
(als Lissy, Tochter des Bankdirektors (Hermann
Seldeneck); Ernst
Rückert
als Baumeister Arno Jessen)
- 1918: Die Schuld des Dr. Adrian Dorczy
(als Salome, Tochter des Trödlers Moses Simon (Victor
Janson) und
Rosita, ein spanisches Mädchen; Johannes Müller als Dr. Dorczy, Spezialist für Giftlehre)
- 1921: Die Rache der Spionin (mit Eva Speyer als Rita, der Ehefrau von Carlo Remy
(Ernst Rückert);
als Ritas Freundin Lissy Brauns) → IMDb
- 1916:
Die Braut des Reserveleutnants / Die Mission der Gräfin Cerutti
(R: Georg
Jacoby; als ?) → Early Cinema Database
- 1916: Die
Dawadasi (R: Heinz
Karl Heiland; als indische Tempeltänzerin) → Early Cinema Database
- 1916: Ein toller Einfall (nach dem Schwank von Carl Laufs;
R: Georg
Jacoby; als ?) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Der Spion
(R: Heinz
Karl Heiland; mit Ferdinand
Bonn als Anzio, der Spion; als Gräfin Fonsecca)
- 1917: Im Reiche der Flammen (R: Heinz Karl Heiland; als Kunstschützin Marion)
→ Early Cinema Database
- 1918: Der Flieger von Goerz
(R: Georg
Jacoby; als Giunetta, Harry
Liedtke als Fliegeroberleutnant) → Early Cinema Database
- 1918: Die schöne Jolan
(R: Rudolf Meinert;
als die Magd) → Early Cinema Database
- 1919: Ein Schritt vom Wege
(R: Rudolf Meinert; als ?) → Early Cinema Database
- 1919: Aberglaube
(R: Georg
Jacoby; als die aus einem Wanderzirkus geflohene Militza) → Murnau Stiftung
- 1919: Die Tochter des Mehemed
(R: Alfred
Halm; als Leila, Tochter des Schuhmachers Mehemed (Max
Kronert),
spätzer Ehefrau des Vaco Juan Riberda (Emil
Jannings), dem Freund des Dr. van Zuylen (Harry
Liedtke)) → filmportal.de
- 1919: Das
Kloster von Sendomir / Elga (nach der Novelle "Das
Kloster bei Sendomir" von Franz
Grillparzer;
R: Rudolf
Meinert; als als die Tochter des Adligen Elga; Eduard von Winterstein
als Graf Starschensky)
→ Early Cinema Database
- 1919: Das
Teehaus zu den zehn Lotosblüten (R: Georg
Jacoby; als Geisha Mimosa Yotamo, Schwester des japanischen
Wissenschaftlers Dr. Yotamo (Meinhardt
Maur)) → Murnau Stiftung
- 1919: De Profundis (nach dem Roman "My Official Wife"
von Richard Henry Savage;
R: Georg Jacoby; als Sonja)
→ IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Das Spielzeug der Zarin
(R:Rudolf
Meinert; als russische Zarin Katharina
II.; Joseph
Roemer als Graf
Alexei
Grigorjewitsch Orlow, deren Liebhaber)
- 1919: Der rote Henker
(frei nach dem Roman "Marion Delorme" von Viktor
Hugo; R: Rudolf
Biebrach; als Marion Delorme;
Magnus
Stifter als Kardinal Armand
Duplessis, der Herzog von Richelieu, genannt der "rote
Henker") → Murnau Stiftung
- 1920: Die letzten Kolczaks
(R: Alfred
Halm; als Olga, Tochter des hoch verschuldeten Gutsherrn
Stanislaus von Kolczak (Victor
Janson))
- 1920: Brigantenliebe
(R: Martin
Hartwig; als Fiametta, Hans
Adalbert Schlettow als Brigant
(Räuberhauptmann) Carlo)
- 1920–1921: Filme unter der Regie von Adolf
Gärtner
- 1922–1930: Filme unter der Regie ihres Ehemaanes Willi
Wolff
Tonfilme (als Darstellerin; Regie: Willi
Wolff)
- 1931: Die Abenteurerin von Tunis
(als Tänzerin Colette) → Murnau Stiftung, filmportal.de
- 1932: Strafsache von
Geldern / Willi Vogel, der Ausbrecherkönig (als Martha,
Ehefrau des Rechtsanwalts
Paulus van Geldern (Paul
Richter; Fritz
Kampers als Willi Vogel, genannt "der Ausbrecherkönig";
auch P) → filmportal.de
- 1932: Das Geheimnis um Johann
Orth. Ein Liebesroman im Hause
Habsburg (mit Karl
Ludwig Diehl als österreichischer
Erzherzog Johann
Salvator alias Johann Orth; mit der Musik, nach Motiven von Johann
Strauss (Sohn); Carl Millöcker
und Joseph Lanner;
als Olga Rostowskaja, Gattin des Fürsten Rostowsky
(Paul
Wegener); Paul Richter als
Rudolf,
Kronprinz von Österreich und Ungarn, Sohn von Kaiser Franz
Joseph I. (Paul
Otto); auch P)
→ filmportal.de (Foto)
- 1933: Manolescu, der Fürst der
Diebe (mit Iván
Petrovich als Georges
Manolescu; als Olivia, Gattin von Jan Hendricks,
Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft (Alfred
Abel); auch P)
|
|

