|
Hella Moja wurde am 16. Januar 1892*) als Helene Gertrud Mojzesczyck
im damals preußischen Königsberg1)*)
(heute: Kaliningrad1))
geboren. Nach dem frühen Verlust ihrer Eltern, war
sie zunächst als Übersetzerin
(Polnisch, Russisch) bzw. als Autorin in Hannover für die "Deutsche Presse-Korrespondenz"
und in Berlin für den "Ullstein-Verlag"1)
sowie den "Scherl-Verlag" von August Scherl1) tätig. Später ließ sie sich von Emanuel Reicher1) (1849 – 1924) an dessen
"Reichersche Hochschule für dramatische Kunst" sowie von Frida Richard
(1873 – 1946) zur Schauspielerin ausbilden. Ihr
Bühnendebüt gab Hella Moja 1913 am Berliner "Lessingtheater"1),
dem für die nächsten zwei Jahre verbunden blieb und oft im Wechsel mit der
berühmten Käthe Haack
(1897 – 1986) auftrat. Auch an anderen Berliner
Theatern wie beispielsweise dem jüdischen "Jargontheater"
"Folies Caprice" avancierte sie
bald zu einer beliebten und gefeierten Mimin.
Zum noch jungen Medium Kinematographie1) kam Hella Moja,
wie sich nun mit Künstlernamen nannte, Mitte der 10er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts vornehmlich durch den Schauspieler und zu der Zeit für
"Decla-Film" als Regisseur tätigen Alwin Neuß
(1879 – 1935), der sie in seinen Streifen "Streichhölzer, kauft Streichhölzer!"1) (1916),
"Der Weg der Tränen"1) (1916)
und "Komtesse Hella"1) (1916)
als Hauptdarstellerin besetzte. Hella Moja vor 1929 auf einer
Fotografie von Alexander Binder1)
(1888 – 1929)
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com;
Photochemie-Karte Nr. 1376
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
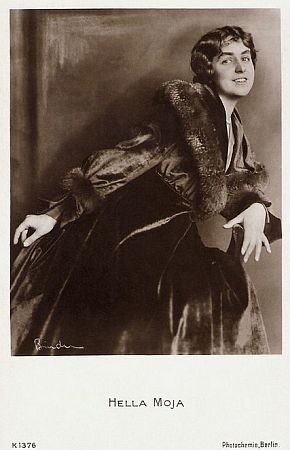
|
 |
Die Schauspielerin machte vor allem in den melodramatischen
Geschichten jener Jahre Furore, mimte oft Gräfinnen, verarmte
Adlige oder Burgfräulein, gehörte bis Mitte der 1920er Jahre zu
den erfolgreichsten Darstellerinnen der deutschen Stummfilm-Szene. 1918 gründete sie in Berlin ihre eigene
"Hella Moja Film-Gesellschaft m.b.H.", arbeitete vor allem
mit Regisseur Otto Rippert1) (1869 – 1940) zusammen, der
etliche Stummfilme mit ihr als Protagonistin realisierte,
unter anderem die Melodramen "Wenn
die Lawinen stürzen" (1917), "Die
Fremde"1) (1917), "Heide-Gretel"1) (1918) oder das zur Zeit Napoléon Bonapartes angesiedelte
Rührstück "Gräfin
Walewska"1) (1920). Die Geschichte um die
polnische Gräfin Maria Walewska1) (1786 – 1817),
Geliebte Napoleons I.1) und Mutter des gemeinsamen Sohnes Alexandre Colonna-Walewski1) wurde 1937
in den USA mit keiner geringeren als der legendären Greta Garbo
erneut unter dem Titel "Conquest"1)
("Maria Walewska") auf die Leinwand gebracht.
Mit Regisseur Max Mack1)
(1884 – 1973) drehte Hella Moja beispielsweise "Figaros Hochzeit" (1920)
nach der Komödie
"La
folle journée, ou le Mariage de Figaro"1)
von Beaumarchais1),
Theater-Star Alexander Moissi war als Titelheld ihr Partner, Mojas
Darstellung des Figaro-Pagen Cherubino galt damals als besonders
beeindruckend und ausdrucksstark.
Hella Moja um 1920 auf einer
Fotografie von Nicola Perscheid1) (1864 – 1930)
Quelle: Wikimedia Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
Einen ihre letzten großen Leinwanderfolge feierte sie mit
der Titelfigur in dem von Rudolf Biebrach in Szene gesetzten Kostüm-Stummfilm "Felicitas Grolandin"1) (1923),
in dem sie, als Page verkleidet, in die Dienste des Schwedenkönigs Gustav Adolf1)
trat; die Handlung ähnelte der 1882 von Conrad Ferdinand Meyer1) veröffentlichten Novelle "Gustav Adolfs Page"1).
1922 rief sie die bis 1927 existierende "Hella Moja Film AG"
ins Leben, bei der ihr späterer Ehemann, der Filmregisseur Heinz Paul1)
(1893 – 1983), zum Vorstand gehörte und sie selbst als
Aufsichtsratsmitglied und Aktionärin am Unternehmen beteiligt war.
Ab Mitte der 1920er Jahre verblasste ihr Ruhm als Darstellerin, das
Publikum empfand ihre theatralischen Interpretationen als altmodisch
bzw. nicht mehr
zeitgemäß. Das von Heinz Paul mit Carl de Vogt
als Otto Weddigen1), Kapitän der "U 9"1) und der "U 29", inszenierte
Kriegsdrama "U 9 Weddigen"1) (1927)
war Hella Mojas letzte Arbeit für den Stummfilm als
Schauspielerin, trat als Cousine des 1. Offiziers Gerhard von Dietrichsen (Gerd Briese) auf, der sich mit
Hilde verloben möchte → Übersicht Stummfilme als Darstellerin.
Hella Moja auf einer
Fotografie von Alexander Binder1)
(1888 – 1929)
Quelle: www.cyranos.ch;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
 |
|

|
Nach rund fünfzig Stummfilm-Produktionen beendete Hella Moja
ihre erfolgreiche Karriere als Schauspielerin, verlegte sich nun ganz
auf das Schreiben von Drehbüchern. Bereits die Scripts zu den
Streifen "So ein Mädel" (1920) und "Die Straße des Vergessens" (1926),
in denen sie als Hauptdarstellerin in Erscheinung trat, trugen ihre Handschrift.
Bis 1936 lieferte sie meist als
Co-Autorin elf weitere Drehbücher zu Filmproduktionen ab, die
überwiegend von Heinz Paul in Szene gesetzt wurden → Übersicht Arbeiten als
Drehbuch-Autorin.
Während des Nazi-Regimes bekam Hella Moja Schwierigkeiten,
da sie keinen so genannten "Ariernachweis"1) erbringen konnte; 1934 änderte sie ihren Namen in "Helka Moroff".
Im Jahre 1937 stellte sie einen Antrag auf
erneute Pseudonym-Änderung, von "Helka Moroff" in "Elka Moroff", im Dezember 1938 wurde
sie aus der "Reichsschrifttumskammer"1) (RSK) ausgeschlossen, mit der Begründung, sie sei lediglich
nebenberuflich schriftstellerisch tätig.
Hella Moja um 1920 auf einer
Fotografie von Nicola Perscheid1) (1864 – 1930)
Quelle: Wikimedia Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
Die einst gefeierte Schauspielerin, die neben Asta Nielsen,
Henny Porten,
Mia May
oder Fern Andra eine Zeit lang zu den Stars der Stummfilm-Szene gehörte, sowie Filmproduzentin und
Drehbuch-Autorin Hella Moja starb am 15. Januar 1937 in der Nacht vor ihrem
45. Geburtstag in Berlin an den Folgen einer Lungenentzündung. Die letzte
Ruhe fand sie auf dem Berliner "Waldfriedhof Heerstraße"1) im
heutigen Ortsteil Westend1);
die Grabstätte wurde inzwischen aufgelöst.
|

|
Quelle (unter anderem): Wikipedia,
Deutsches
Filminstitut**)
Siehe auch cyranos.ch;
Fotos bei filmstarpostcards.blogspot.com
|
*) Laut Wikipedia gemäß "Landesarchiv
Berlin", Geburtsregister Standesamt Königsberg (Pr. II, Nr. 167/1892); in der Heirats- und Sterbeurkunde wird als Geburtsjahr fälschlich 1898 angegeben.
**) Aus: Hansch, Gabriele / Waz, Gerlinde: Filmpionierinnen in Deutschland.
Ein Beitrag zur Filmgeschichtsschreibung (Berlin 1998, unveröffentlicht)
Fremde Links: 1) Wikipedia
Lizenz Fotos Hella Moja (Urheber: Alexander
Binder, Nicola Perscheid): Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei,
weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die
Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren
Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod
des Urhebers.
|

|
Filme
Als Darstellerin / Als Drehbuch-Autorin
Filmografie bei der Internet Movie Database, filmportal.de
sowie
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"
(Fremde Links: Murnau Stiftung, Wikipedia, filmportal.de,
cyranos.ch;
R = Regie) |
Als Darstellerin (Stummfilme, Auszug)
- 1915: Die weiße Rose (R: Franz
Hofer; als ?) → IMDb
- 1915: Das Spiel mit dem Tode
(R/Drehbuch: Urban
Gad; als ?)
- 1915: Der Krieg versöhnt (von (Regie/Drehbuch) und mit Ludwig
Trautmann; als ?) → Early Cinema Database
- 1916: Filme unter der Regie von Alwin Neuß
- 1916–1921: Filme unter der Regie von Otto Rippert
- 1918: Wundersam ist das Märchen der Liebe (von
(Regie) und mit Leo Connard);
als ?) → Early Cinema Database
- 1918: Sie und er (Kurzfilm; R: ?; als Sie, Harry Lamberts-Paulsen
als Er) → Early Cinema Database
- 1918: Vor den Toren des Lebens (Kurzfilm; R: ?; als ?) → Early Cinema Database
- 1918–1919: Filme unter der Regie von Iwa Raffay
- 1919: Das Spiel von Liebe und Tod
(R/Drehbuch: Urban
Gad; als Roma-Frau) → Early Cinema Database,
Foto bei flickr.com
- 1919: Das Werkzeug des Cosimo
(R: Alfred
Halm; als Felicitas / Gustava, Adoptivtochter von Frau von Essla
(Elsa
Wagner);
Ferdinand
Bonn als Conte Cosimo da Ponte)
- 1920: So ein Mädel (R:
Urban Gad; als ?; auch Drehbuch) → IMDb
- 1920: Die Tänzerin von Tanagra
(R: Heinz
Paul; als Praxedis, Mündel von Bildhauer Avardos (Fritz Alten))
→ Early Cinema Database
- 1920: Der Vampyr
(R: Fred
Stranz; als ?)
- 1920: Der Abgrund der Seelen
(R/Drehbuch: Urban
Gad; als ?)
- 1920: Figaros Hochzeit
(nach der Komödie "La
folle journée, ou le Mariage de Figaro" von Beaumarchais;
R: Max
Mack;
mit Alexander
Moissi als Figaro; als Chérubin, erster Page des Grafen
Almaviva (Eduard
von Winterstein))
- 1920/21: Glasprinzessin
(R: Fritz
Richard; als die Gräfin) → Early Cinema Database
- 1920/21: Mein Leben als Nachtredakteur
(R: Urban
Gad; als ?) → Early Cinema Database
- 1921: Christian Wahnschaffe (nach dem Roman von Jakob
Wassermann; R: Urban
Gad; mit Conrad
Veidt;
als Christian Wahnschaffe)
- 1922: Der schwarze Montag
(R: Robert
A. Dietrich; als ?)
- 1923: Das schöne Mädel
(nach dem Roman von Georg
Hirschfeld; R: Max
Mack; als Afra, Tochter des Ehepaares
Gött (Ilka
Grüning/Fritz
Richard)
- 1923: Felicitas Grolandin
(R: Rudolf
Biebrach; als Felicitas Grolandin)
- 1923: Fiat Lux
/ …und es ward Licht! (R: Wilhelm
Thiele; als die Blinde) → IMDb
- 1924: Düstere Schatten, strahlendes Glück
(R: Max Erhardt; als ?)
- 1924: Der Mann um Mitternacht
(von (Regie) und mit Holger-Madsen;
als Else; mit Olaf Fjord)
→ IMDb
- 1924/25: Ihre letzte Dummheit
(R: Richard
Arvay; als ?)
- 1925: Des Lebens Würfelspiel
(als Änne, Tochter der Witwe Krüger (Frida
Richard))
- 1926: Die Warenhausprinzessin
(R: Heinz
Paul; als eine verarmte russische Prinzessin; Kurzinfo: Eine im
Exil lebende russische Prinzessin ist so verarmt,
dass sie als Schaufensterpuppe in der Bekleidungsabteilung
eines Kaufhauses
arbeitet.)
- 1926: Die Straße des Vergessens (R:
Heinz
Paul; als Viola, Tochter der Marquise de Revera (Ida
Wüst); auch Drehbuch)
- 1927: U 9 Weddigen
(R: Heinz Paul; mit Carl
de Vogt als Otto
Weddigen, Kapitän der "U
9" und der "U 29";
als Hilde, Cousine des 1. Offiziers Gerhard von Dietrichsen (Gerd
Briese); Hans
Mierendorf als dessen Onkel
und Hildes Vater) → filmportal.de
Als Drehbuch-Autorin (Regie: Heinz
Paul, wenn nicht anders genannt)
|
|

|
Hella Moja, aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin
(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))
Quelle: filmstarpostcards.blogspot.com
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
 |
 |
| "Film-Sterne" Nr.
165/3 |
"Film-Sterne" Nr.
134/1 |
| |
 |
 |
|
|
|
Lizenz Foto Hella Moja (Urheber: Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker
(1849–1892) / Heinrich Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,
weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für
das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer
gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod
des Urhebers.
|

