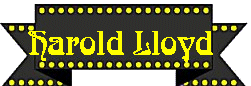
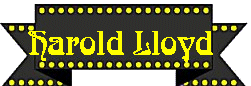
| Harold Lloyd (Harold Clayton Lloyd) erblickte am 20. April 1893 als zweiter Sohn von James Darsie Lloyd (1864 – 1947) und dessen Ehefrau Elizabeth (1868 – 1941) in dem kleinen Ort Burchard1) (Nebraska1)) das Licht der Welt. Harolds Vater wird in einigen Quellen als erfolgloser Fotograf bezeichnet, der in San Diego1) eine Billardhalle aufmachte, andere Quellen wiederum nennen als Beruf Verkäufer. Der ältere Bruder Gaylord Lloyd (1888 – 1943) sollte später in mehreren seiner Filme mitwirken, vor allem als Harolds Doppelgänger in dem Slapstick-Streifen "His Royal Slyness"1) (1920, "Der falsche Prinz"). | ||||||
Partnerin in etlichen Kurzfilmen war Stummfilm-Star Bebe Daniels (1901 – 1971) sowie ab 1919 Lloyds spätere Ehefrau Mildred Davis1) (1901 – 1969), die er 1923 heiratete und mit der er auch in einigen Langfilmen gemeinsam auftrat. Ab 1923 war dann Jobyna Ralston1) (1899 – 1967) seine bevorzugte Mitspielerin. Harold Lloyd holte seine Konkurrenten Charlie Chaplin und Buster Keaton (1895 – 1966) bald ein, erzielte mit seinen Filme teilweise mehr finanzielle Erfolge an den Kinokassen als diese und war zeitweilig der höchstbezahlte Star der Branche. Mehr und mehr verzichtete Harold (der wesentlichen Einfluss auf die Regie nahm, ohne genannt zu werden) auf den Slapstick der frühen Jahre und setzte auf die Entwicklung der Figuren und durchkonstruierte Storys. Sein Markenzeichen waren artistische Höhepunkte auf Wolkenkratzern, die Harold als geübter Sportler immer selbst spielte. Dennoch schreiben Ulrich Gregor1) und Enno Patalas1) in ihrer 1962 veröffentlichten "Geschichte des Films": "Harold Lloyd war kein kompletter Autor wie Chaplin und Keaton, sondern nur ein Schauspieler mit einer festumrissenen Rolle, auf die die Handlungen und Gags seiner Filme zugeschnitten wurden. Keiner seiner Filme … besitzt einen individuellen Stil … auch Harold Lloyd verkörperte einen amerikanischen Helden, aber keinen mythischen, sondern einen aktuellen … Lloyds spezielle Komik resultierte aus dem Übereifer, den er bei der Beachtung der gesellschaftlichen Spielregeln an den Tag legt, und seiner anfänglichen Unbeholfenheit. Nachdem er zunächst Chaplins äußere Erscheinung imitiert hatte, gab er ab 1917 seiner Gestalt die Kontur des völlig untragischen, auf Anpassung bedachten jungen Kleinbürgers … voll guten Willens und absoluten Vertrauens in die Gerechtigkeit der Welt. Bedingungslos ist seine Sucht, es allen recht zu machen. Unempfindlich gegen Erniedrigungen, lässt er sich verhöhnen, quälen, ausnutzen". Dessen ungeachtet war und blieb Lloyd ein Kassenmagnet, Liebling bei Erwachsenen und Kindern. Seine "Stunts" waren oft nicht ungefährlich: 1920 explodierte bei den Dreharbeiten zu "Haunted Spooks"2) ("Entgeisterte Gespenster") ein Zündkörper in seiner rechten Hand – Harold verlor Daumen und Zeigefinger. Er trug anschließend einen Spezialhandschuh, der das Handicap nur bei genauem Hinsehen sichtbar machte, und war trotz teilweiser Lähmung der Hand in der Lage, seine Kunststücke selbst auszuführen. Als Regisseure bei den Langfilmen fungierten meist Fred C. Newmeyer1) (1881 – 1967), manchmal gemeinsam mit Sam Taylor1) (1895 – 1958). Auch in Deutschland erfreute sich Lloyd – als "Er" bezeichnet – einer großen Beliebtheit, für die Deutschen waren seine Figuren mit allen Attributen des amerikanischen Durchschnittsbürgertums ausgestattet.
Sein erster Tonfilm hieß "Harold, der Drachentöter"1) (1929, " Welcome Danger"), wo er als der sanftmütige Botaniker Harold Bledsoe bzw. Sohn des früheren Polizeichefs in Erscheinung trat, der im Kampf gegen chinesische Drogengangster zum Einsatz kommt, in der Slapstick-Komödie "Harold, halt dich fest!"1) (1930, "Feet First") war er dann der ehrgeizige, aber nicht allzu erfolgreiche Schuhverkäufer Harold Horne. Als typischer, amerikanischer Provinzler Harold Hall tauchte der Komiker in der amüsanten Geschichte "Filmverrückt"1) (1932, "Movie Crazy" auf, der auf Grund einer Verwechslung zu Probeaufnahmen nach Hollywood fährt und schon bald die Kinometropole völlig auf den Kopf stellt – Regie führte Clyde Bruckman1), der das Buster Keaton-Meisterwerks "Der General"1) (1926, "The General") in Szene gesetzt hatte, Lloyd selbst blieb als Co-Regisseur ungenannt. Nach "Harold Lloyd, der Strohmann"1) (1934, "The Cat's Paw") und seinem Part des ein wenig naiven Missionarssohn Ezekiel Cobb folgte mit "Ausgerechnet Weltmeister"1) (1936, "The Milky Way") eine weitere Komödie, in der er als Milchmann Burleigh Sullivan auftrat, "Inbegriff eines lieben, netten und schüchternen Menschen, der niemandem etwas zu Leide tun kann."3) In seinem vorletzten Spielfilm mit dem Titel "Der gejagte Professor" (1938, "Professor Beware") stellte er den im Museum beschäftigter ehrgeizigen Professor für Ägyptologie Dean Lambert dar, der "unter allen Umständen den Ausgang einer Liebesgeschichte erforschen, die sich vor 3000 Jahren im Reich der Pharaonen zugetragen hat. Dabei gerät er unversehens in fatale Verstrickungen mit der Polizei und einer heiratswütigen jungen Frau. Gagreiche, vergnügliche Komödie, die aber wegen ihrer Unausgeglichenheit das Niveau von Lloyds besten Werken nur gelegentlich erreicht." notiert filmdienst.de. Während des 2. Weltkrieges arbeitete Lloyd nur als Produzent, erst 1947 trat er wieder als Darsteller auf: Mit Preston Sturges1) (1898 – 1959), einem der großen Komödienregisseure des damaligen amerikanischen Films, drehte er "Verrückter Mittwoch1) (1947, "The Sin of Harold Diddlebock", doch die Produktion wurde kurz nach dem Start von Co-Produzent Howard Hughes1) wegen des Misserfolgs an den Kinokassen zurückgezogen. Drei Jahre später kam der Streifen in einer völlig veränderten Schnittfassung als "Mad Wednesday" (1950) erneut in den Verleih, blieb jedoch wiederum hinter den finanziellen Erwartungen zurück. Die Geschichte handelt von dem einst umjubelten American-Football1)-Helden Harold Diddlebock, der nun als Buchhalter bei dem Geschäftsmann E.J. Waggleberry (Raymond Walburn1)) ein eher langweiliges Leben führt. Eine Weile altert Harold im Laufe der Dienstjahre vor sich hin, bis er dann, von Waggleberry, entlassen, doch noch auf Touren kommt. Diddlebock ertränkt seinen Kummer in Alkohol und erwirbt im Vollrausch einen insolventen Zirkus, der ihm nun absurde Probleme bereitet. Sturges brachte in die locker-lakonische Geschichte – wie in all seinen Filmen – einiges an Sozialkritik ein, und natürlich turnte Lloyd wieder an der Fassade eines Wolkenkratzers herum "Preston Sturges' Hommage an und mit Harold Lloyd erschließt sich wegen vieler Sequenzen, die Lloyds Humor diametral entgegengesetzt sind, dem Laien leichter als dem Freund von Lloyds Werk, dürfte aber als weitgehend geglückte Groteske von jedermann mit großem Vergnügen goutiert werden können. Auf jeden Fall hat kaum eine Komikerkarriere ein besseres Finale gefunden." vermerkt filmdienst.de. Nominiert 1951 in der Kategorie "Bester Schauspieler – Musical/Komödie"1) für einen "Golden Globe"1) errang Lloyd für seine Darstellung in "Mad Wednesday" eine künstlerische Anerkennung, unterlag jedoch Fred Astaire in dem Filmmusical "Drei kleine Worte"1) ("Three Little Words"). Es war Lloyds letzte Arbeit vor der Kamers, danach zog er sich ins Privatleben zurück → Übersicht Tonfilme. 1952 erhielt Harold Lloyd, der zu den 36 Gründern der "American Academy of Motion Pictures"1) zählt, den "Ehrenoscar"1) als "herausragender Komödiant und guter Bürger". 1960 wurde er mit einem "Stern" auf dem "Hollywood Walk of Fame"1) (Nähe 6840 Hollywood Blvd. und 1501 Vine Street) geehrt. Posthum erhielt der legendäre Komiker eine weitere Auszeichnung, 1994 gab der " United States Postal Service" eine 29-Cent-Briefmarke heraus, entworfen von dem Cartoon-Zeichner Al Hirschfeld1). In den 1960er Jahren macht Lloyd mit der Vermarktung seiner Filme, für die er die Rechte behalten hatte, ein Vermögen. 1962 feierte bei den "Internationalen Filmfestspielen von Cannes"1) ein Kompilationsfilm1) aus alten Lloyd-Filmen unter dem Titel "Harold Lloyd's World of Comedy"3) ("Selten so gelacht") Premiere, der anwesende Künstler erhielt eine "Standing Ovation". Eine weiterer aus Lloyd-Streifen zusammengesetzter Film erschien 1963 unter dem Titel "The Funny Side of Life"3) ("Spaß muss sein"). "Diese Kompilationsfilme weckten ein erneutes Interesse an der Arbeit des Komikers, aus rechtlichen Gründen war es jedoch erst 1974 – nach Lloyds Tod – möglich, seine Filme in ihrer integralen Fassung wiederaufzuführen. Der "Time-Life"1)-Konzern hatte die Rechte erworben und wertete die Filme im Kino sowie im Fernsehen erneut aus. Lloyd hatte sich lange dagegen gesperrt, seine Filme ohne weitere Bedingungen an das Fernsehen oder an die Kinos zu verkaufen, weil er zum Beispiel durch Werbeblöcke oder Zusammenschnitte eine Zerstörung seiner Filme fürchtete. Seine Filme waren deshalb lange nur wenig zugänglich." kann man bei Wikipedia lesen.
Lloyd war der ewige Pechvogel, der nette Junge von nebenan, der immer wieder in die komischsten Situationen gelangte und darüber selbst erstaunt war. Er war einer der hochbegabten Komiker, doch anders als Charlie Chaplin und Buster Keaton vergaß man ihn ganz einfach für Jahrzehnte, bis ihn das Fernsehen – zumindest hierzulande – Ende der 1970er Jahre wiederentdeckte. Wilfried Wiegand1) (1937 – 2020), einstiger Feuilletonchef (1986–1996) und Paris-Korrespondent (1981–1985/1997–2001) der "Frankfurter Allgemeine Zeitung"1), schrieb in einem F.A.Z.-Nachruf unter anderem: "Zwei Merkmale unterschieden Lloyd von seinen heute berühmteren Kollegen. Einmal war er einer der ganz wenigen Komiker überhaupt, deren Gags nicht durch Entstellungen von Statur oder Physiognomie in Szene gesetzt wurden. Er war weder dick noch dünn, noch lang, noch klein. Und weder lachte er übertrieben, noch fiel er durch demonstrativen Ernst auf. Und weiterhin: Gerade die unbestreitbar größten Komiker, Chaplin und Keaton nämlich, hatten den Typ des Gescheiterten, des im Leben zu kurz Gekommenen verkörpert – eine Identifikationsmöglichkeit, auf der letztlich auch der Erfolg Laurels, Hardys und Langdons beruhte. Harold Lloyd hingegen war kein Außenseiter, weder im Leben noch im Film. Dem Schauspieler war, nachdem der Erfolg sich erst einmal eingestellt hatte, die Ruhe eines bürgerlichen Lebens, fern von allen Skandalen, geblieben: Nur eine einzige Ehe, Reichtum bis zum Lebensende – für Hollywood ein Ausnahmefall." Wikipedia führt aus: "Über das Leben und Werk von Harold Lloyd, seine Bedeutung für die Comedy und insbesondere das Slapstick-Genre sowie seine Relation zu den anderen großen Komikern seiner Zeit wurde 2017 von dem deutschen Autor und Regisseur Andreas Baum1) im Auftrag von ZDF/ARTE eine internationale TV-Dokumentation mit dem Titel "Harold Lloyd: Hollywoods zeitloses Comedy-Genie"4) (englischer Titel: "Harold Lloyd: Hollywood´s Timeless Comedy Genius") produziert. Der Film präsentiert neben zahlreichen Filmausschnitten u. a. viele bis dato unveröffentlichte Fotos, Dokumente und Interviews, z. B. mit Familienangehörigen, Freunden und anderen Komikern sowie zahlreiche seltene Privataufnahmen des Stars und ist seit 2017 in einem längeren "Director´s Cut" mit zusätzlichem Bonusmaterial auch auf DVD erhältlich." → programm.ard.de |
||||||
|
|
||||||
|
Textbausteine des Kurzportraits von prisma.de (Artikel
nicht mehr online); Webpräsenz (in englisch): haroldlloyd.com; siehe auch Wikipedia (deutsch), Wikipedia (englisch), cyranos.ch Fotos bei virtual-history.com, Wikimedia Commons, filmstarpostcards.blogspot.com |
||||||
|
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) filmdienst.de, 4)
fernsehserien.de 3) Quelle: Wikipedia Lizenz Foto Harold Lloyd (Urheber Albert Witzel): Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei. Lizenz Foto Harold Lloyd und Ehefrau Mildred Davis: Dieses Werk stammt aus der National Photo Company-Sammlung der "Library of Congress". Laut der Bibliothek gibt es keine bekannten Copyright-Einschränkungen in der Verwendung dieses Werkes. |
||||||
|
|
||||||
|
|
Um zur Seite "Die stummen Stars" zurückzukehren, bitte dieses Fenster schließen. Home: www.steffi-line.de |