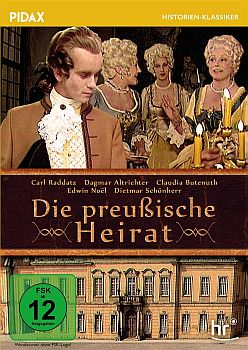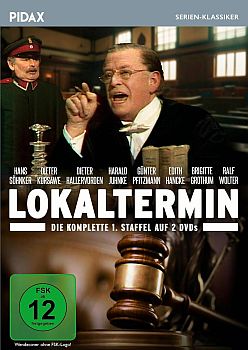Filme
Kinofilme / Fernsehen
Filmografie bei der Internet Movie Database
sowie filmportal.de
(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, Die Krimihomepage,
felix-bloch-erben.de, fernsehserien.de, deutsches-filmhaus.de; R = Regie)
|
Kinofilme
- 1935: Das
Mädchen Johanna (R: Gustav
Ucicky; über Jeanne
d’Arc, dargestellt von Angela
Salloker;
ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de
- 1938: Andalusische Nächte (nach der Novelle
"Carmen" von Prosper Mérimée;
R: Herbert
Maisch;
mit Imperio Argentina als
Tänzerin Carmen; als Schmuggler Triqui)
- 1940: Das
Herz der Königin (R: Carl
Froelich; mit Zarah Leander als
Maria Stuart;
als Nelson, Begleiter des
Henry Darnley (Axel
von Ambesser)) → filmportal.de
- 1941: U-Boote
westwärts! (Vorbehaltsfilm;
R: Günther
Rittau; als Matrose Gefreiter Wackerle) → filmportal.de,
Murnau Stiftung
- 1941: Das
tapfere Schneiderlein (nach dem gleichnamigen
Märchen
der Gebrüder Grimm;
R: Hubert
Schonger;
als das tapfere Schneiderlein)
- 1942: Ein
Windstoß (nach dem Bühnenstück "Un colpo di vento" von
Giovacchino Forzano;
R: Walter
Felsenstein;
als Mann mit Radio) → filmportal.de
- 1944: Der Verteidiger hat das Wort
(R: Werner
Klingle; mit Heinrich
George als Straverteidiger Justizrat Jordan;
als Angeklagter im ersten Prozess) → filmportal.de
- 1951: Corinna Schmidt
(DEFA-Produktion
frei nach dem Roman "Frau
Jenny Treibel" von Theodor
Fontane;
R/Drehbuch: Artur
Pohl; mit Ingrid
Rentsch als Corinna Schmidt; als deren Vater Prof. Willibald Schmidt;
Trude
Hesterberg
als Frau Kommerzienrätin Jenny Treibel) → filmportal.de,
defa-stiftung.de
- 1953: Hab Sonne im Herzen
(R: Erich
Waschneck; als Herr Knäbich) → filmportal.de
- 1954: Mädchen mit Zukunft (R:
Thomas
Engel; mit Herta
Staal als junge Privatdetektivin Inge Wendler; ungenannte Nebenrolle)
- 1954: Glückliche
Reise (R: Thomas Engel; ungenannte Nebenrolle) → IMDb
- 1955: Vor Gott und den Menschen (R:
Erich
Engel; mit Antje Weisgerber
und Viktor de Kowa als Ehepaar/Rechtsanwälte
Maria und Dr. Martin Lenz: als Trompeter Vogel)
- 1955: Alibi
(R: Alfred
Weidenmann; als Kneipengast) → filmportal.de
- 1956: Nacht
der Entscheidung (R: Falk
Harnack; als Jules) → filmportal.de
- 1956: Ein
Mädchen aus Flandern (nach der Novelle "Engele von
Loewen" von Carl
Zuckmayer; R: Helmut
Käutner;
mit Nicole Berger und
Maximilian Schell;
als 2. Revolutionär) → filmportal.de
- 1957: Wie ein Sturmwind
(nach dem "Hörzu"-Roman von
Eduard
Rhein alias Klaus Hellmer; R: Falk
Harnack;
ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de
- 1958: Das Mädchen aus Hamburg
/ La fille de Hambourg (R: Yves
Allégret; mit
Hildegard
Knef (Maria) und
Daniel
Gélin (Seemann Pierre); ungenannte Nebenrolle) → IMDb,
spiegel.de,
filmmuseum-hamburg.de
- 1959: Buddenbrooks
(2 Teile, nach dem gleichnamigen
Roman
von Thomas Mann;
R: Alfred
Weidenmann;
als Zahnarzt Brecht in Teil
2) → filmportal.de
- 1960: Bumerang
(nach dem gleichnamigen Roman (1959) von Igor
Šentjurc; R: Alfred Weidenmann;
ungenannte Nebenrolle) → filmportal.de
- 1960: Der
letzte Fußgänger (R: Wilhelm
Thiele; mit Heinz
Erhardt in der Hauptrolle des "Rucksack-Wanderers"
Gottlieb Sänger; als Chefredakteur Kleinert) → filmportal.de
- 1960: Bis
dass das Geld Euch scheidet… (nach dem gleichnamigen, in der
Illustrierten "Quick"
erschienenen Roman
von Angela Ritter; R: Alfred
Vohrer; mit Luise Ullrich und
Gert Fröbe als Ehepaar Grapsch;
als Anwalt Dr. Giller)
→ filmportal.de
- 1960: An
heiligen Wassern (nach dem Roman von Jakob
Christoph Heer; R: Alfred
Weidenmann;
als der Wildheuer
Bälzi) → filmportal.de
- 1960: Der
letzte Zeuge (nach dem im "Hamburger
Abendblatt" veröffentlichten Fortsetzungs-"Kriminalbericht"
von
Maximilian Vernberg; R: Wolfgang
Staudte; als Vorsitzender des Schwurgerichts) → filmportal.de
- 1961: Der
Traum von Lieschen Müller (R: Helmut
Käutner; mit Sonja Ziemann als Lieschen Müller
alias Liz Miller;
als Onkel Joe) → filmportal.de
- 1962: Der
42. Himmel / Krach im Standesamt (R: Kurt
Früh; als Fritz Krümel alias Tierbändiger/Bärenführer "Leo Leonis" in
der hochdeutschen Fassung; Schweizerdeutsche Fassung: Paul
Bühlmann) → cyranos.ch
- 1962: Max,
der Taschendieb (R: Imo
Moszkowicz; als Arthur, Kumpan von Max Schilling (Heinz
Rühmann)) → filmportal.de
- 1970: Die
Feuerzangenbowle (nach dem gleichnamigen
Roman
von Heinrich Spoerl bzw. Remake des Films
aus dem Jahr 1944
mit Heinz
Rühmann; R: Helmut
Käutner; mit Walter
Giller als Dr. Hans Pfeiffer; als Mitglied der Tischrunde)
→ filmportal.de
- 1971: Das Freudenhaus
(nach dem Roman von Henry
Jaeger; R/Drehbuch: Alfred
Weidenmann; als Schachspieler)
→ filmportal.de
Fernsehen (Auszug)
- 1957: Der Tod des Sokrates (nach
dem Werk "Phaidon"
des Platon;
R: Ludwig
Berger; als Sokrates)
- 1957: Das Geheimnis
(nach
dem Schauspiel "The Potting Shed" von Graham
Greene; R: Werner
Völger;
als Dr. Fredrick Baston) → Wikipedia
(englisch)
- 1957: Der Parasit
(nach der gleichnamigen
Komödie von Friedrich Schiller,
basierend auf dem Lustspiel von
Louis-Benoît Picard;
R: Konrad Wagner;
als Beamter LaRoche, Subalterner des Ministers Narbonne (Reinhard Nietschmann))
- 1958: Der
Widerspenstigen Zähmung (nach der gleichnamigen
Komödie
von
William Shakespeare; R: Ludwig
Berger;
mit Ursula Lingen als
Katharina, Günter Pfitzmann als Petruchio;
als der stets betrunkene Kesselflicker Christoph Schlau)
- 1958: Maß für Maß
(nach der
gleichnamigen
Komödie von William Shakespeare in der Übersetzung von August
Wilhelm Schlegel;
R: Ludwig
Berger; als Elbogen, ein einfältiger Gerichtsdiener; Kurzinfo: Herzog Vincenzo
(Alexander
Kerst) will dem
sittlichen Verfall von Vienna durch harte Gesetze begegnen. Er gibt Statthalter Angelo
(Herbert
Tiede) Regierungsgewalt
und geht selbst als Mönch unter die Leute. Zur selben Zeit wird der junge Edelmann Claudio
(Joachim
Mock) der Verführung
angeklagt und vom sittenstrengen Angelo zum Tode verurteilt. In seiner Angst versucht Claudio, seine tugendhafte
Schwester (Ina
Halley) zu einer unehrenhaften Tat zu überreden und so sein Leben zu retten. Isabella aber bleibt sich treu.
Sie verkörpert wie Helena nicht die Liebe sondern das Gewissen …
"Hörzu"
(28/1958): "Maß für Maß" ist die fünfte der erfolgreichen Shakespeare-Inszenierungen Ludwig Bergers
im Fernsehen des SFB. Das Stück hat nichts von der Leichtigkeit und Freiheit der shakespearschen Lustspielwelt.
Statt in Wäldern, Gärten und Schlössern spielt die Handlung in einer kalten, sonnenlosen Umgebung. Die Welt ist
entschleiert, und über ihr schwebt ein hamletisches Grübeln. Dennoch wird die düstere Atmosphäre des Untergangs
vom "Ende gut, alles gut" überstrahlt. "Maß für Maß" gehört zu den letzten Problemstücken Shakespeares, die
weniger Komödien als treffliche Schauspiele mit gutem Ausgang sind.
"Bild + Funk"
(28/1958): Die tragikomische Dichtung "Maß für Maß" setzt die Berliner Reihe der Shakespeare-Inszenierungen
fort, die aus tiefem Ernst in die Bereiche lauterster Komödie in ihrer Handlung vordringt. Sicher steht im Mittelpunkt die
Kontrastierung von Macht, dem Willen zu höherer Ordnung, nach Recht, das beinahe Unrecht wird und schließlich durch
die Gnade in Bezirke freundlicherer Deutung geführt wird. Eine männliche Pflichtwelt, die umstrahlt wird von den weiblichen
Hauptgestalten Isabella, Mariane(Katja Görner)
und Julia (Bärbel Spannuth). Das dramatische Geschehen gewinnt aber seine
Bedeutung aus der Mischung der beiden Elemente von "Spiel und letzten
Lebensbedingungen".
"Hörzu (31/1958) schrieb in ihrer Kritik: Höhepunkt der Woche: Shakespeares Tragikomödie
"Maß für Maß". Mit etwas
Besorgnis sah man dem Unternehmen entgegen. Das Stück ist schwierig: keine reine Komödie, keine reine Tragödie,
viele Personen, anspruchsvolle Rollen. Nur selten wagen sich die großen Bühnen an diese Geschichte von dem Herzog,
der sich nach dem Vorbild Harun al
Raschids verkleidet und unerkannt unter das Volk mischt, um ihm auf die Schliche
zu kommen. Was Ludwig Berger daraus gemacht hat, ist aller Bewunderung wert. Er straffte und raffte, entstaubte und
verdichtete, wohlunterstützt von trefflichen Darstellern; er schuf eine Fernseh-Dichtung, der man nicht mehr anmerkte,
dass die Urform ein Bühnenwerk ist. Lediglich am Ende kam mit dem Jubel des Volkes etwas Bühnentheatralik zu Wort
und sprengte jäh den intimen Rahmen des Bildschirms.
"Gong"
(31/1958) schrieb in seiner Kritik: Was, so fragte ich mich bei der letzten Fernsehinszenierung des Shakespeare-Zyklus,
wäre mit der Komödie "Maß für Maß" geschehen, wenn sie nicht aus der Feder des großen englischen Dramatikers stammte,
sondern im Jahre 1958 von einem unbekannten Autor auf den Tisch eines deutschen Dramaturgen gelegt würde? Ich fürchte,
man gäbe sie ihm wieder zurück: Mit ein paar Bemerkungen über gelungene Details, über die geschickte Handlungsführung
und die Notwendigkeit, in unserer Zeit andere Stoffe zu behandeln. Man mag mich für einen Banausen halten,
aber "Maß für Maß" kann man heute nur noch auf der Bühne, aus der Distanz, die das Geschehen immer als Spiel
erkennen lässt, unbekümmert genießen. Ludwig Berger hat der Versuchung zum Realistischen, die dem Medium Fernsehen
innewohnt, nicht widerstehen können. Unheimlich düster wirkende Kerkermauern aus Gips rückten die Inszenierung
schon von der Szenerie her in die gefährliche Nähe einer Cinemascope-Verfilmung des
Grafen von Monte
Christo. In die
gedämpften oder drastischen Töne der Komödie mischten sich die Elemente der Schauerballade, bei der in Großaufnahme
wuchtige Henkerbeile geschliffen wurden und Isabella, verängstigt ob der drohenden Vergewaltigung, mehrfach das Kreuz
schlug. In der Illusion der Wirklichkeit, die der Bildschirm vermittelt, konnte man das nicht mehr ernst nehmen, und daran
litt auch die Aufführung des "Sender Freies
Berlin". Die gute Besetzung konnte pathetische Übertreibungen nicht
verhindern, die recht bewegliche Kamera fing dort realistische Bilder ein, wo das Spiel schwebend bleiben sollte, und der
Szenenbildner schwelgte am falschen Platz. Shakespeare schrieb für die Bühne und nicht für das Fernsehen:
"Maß für Maß"
hat gezeigt, dass beides mit zweierlei Maßen zu messen ist.
"Hören
und Sehen" (32/1958) schrieb in ihrer Kritik: "Maß für
Maß" inszenierte Ludwig Berger konventionell, aber zügig.
Dies ernsthafte Shakespeare-Lustspiel richtet sich gegen die Puritaner und gegen die Sittenlosen gleichermaßen und weiß
darum auch heute noch zu fesseln, wenn auch vielleicht die keusche Isabella (rührend von Ina Halley verkörpert) kein
Verständnis mehr findet, die lieber des geliebten Bruders Leben opfert als ihre Tugend als Kaufpreis in die Waagschale
zu werfen. (SFB)
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))
→ IMDb,
zeno.org
- 1958: Ein Sommernachtstraum (nach der gleichnamigen
Komödie von William
Shakespeare in der Übersetzung von
August Wilhelm von Schlegel;
R: Ludwig
Berger; als Zettel (im Original: Nick Bottom);
Kurzinfo: Herzog Theseus von Athen
(Alexander
Kerst) bereitet gerade seine Hochzeit mit der besiegten Amazonenkönigin
Hippolyta
(Eva
Lissa) vor, als der einfache Bürger Egeus (Helmuth
Rudolph) vorspricht, um seine Tochter
Hermia (Gardy
Granass) zu verklagen. Hermia weigert sich, den ihr vom Vater zugedachten Demetrius
(Horst
Naumann)
zu heiraten, da sie Lysander (Joachim
Mock) liebt. Das Liebespaar flüchtet in den Wald, verfolgt von Demetrius, der wiederum
von Helena (Ingrid
Stenn) gejagt wird, die ihn anbetet, aber abgewiesen wurde. In der Nacht stolpern die vier in einen
Zauberspuk der Elfen und Kobolde. Elfenkönig Oberon
(Heinz
Giese) erhält von seinem Diener Puck (Renate
Danz) eine
Wunderblume, deren Saft in den verliebt macht, den man beim Erwachen als erstes sieht. Dieser Zaubertrank bringt die
Gefühle der athenischen Liebespaare komplett durcheinander. Währenddessen spielt sich im Wald ein weiterer Elfenspuk ab:
Eine Schar tölpelhafter Handwerker probt das Spiel von Pyramus und
Thisbe, das sie am nächsten Tag dem Herzog vorspielen
wollen. Puck zaubert einem von ihnen einen Eselskopf und ausgerechnet in diesen soll sich Elfenkönigin Titania
(Ina Halley) –
beträufelt mit dem Zaubersaft – verlieben. Im Morgengrauen zerrinnt der Sommernachtstraum …
"Hörzu"
(36/1958) schrieb in ihrer Kritik: Mit dem 'Sommernachtstraum' ist der Shakespeare-Zyklus zu Ende gegangen.
Leider, möchte man sagen. Denn alles in allem haben wir vorzügliches Theater ferngesehen. Ludwig Berger, der für die
Regie und zum Teil auch für die Übersetzung verantwortlich zeichnete, hat sich Schritt für Schritt an die Mittel des
Fernsehens herangetastet und sie gerade in seiner letzten Inszenierung souverän eingesetzt. Das Spiel mit zwei Bildern
(beim Tanz der Elfen) war verblüffend. "Eine technische Spielerei ohne
Zweck", mögen Theaterexperten sagen. Aber die
Illusion des Geisterspuks war vollkommen; was kümmert's, ob sich Oberon nur der Zauberkraft des Worts bediente oder
ob er sich auf den Einfall der Regie und das Können seiner "Untertanen" an den Kameras und am Mischpult verließ!
Uns hat's ebenso gefallen wie das durch Zauber verwirrte Liebesspiel und die köstliche derbe Komik Zettels (Hans Hessling)
und seiner theaterbesessenen Freunde. Abschließend ist zu sagen, dass sich Mühe und Aufwand, die die sechs Aufführungen
gekosten haben, durchaus gelohnt haben. So gebührt allen, die daran beteiligt waren, dem
SFB und dem
NWRV,
den Akteuren, den Technikern und dem Regisseur Anerkennung und Dank.
"Hören
und Sehen" (37/1958) schrieb in ihrer Kritik: Im Lande Utopia, wo die Poesie wächst, ist Shakespeares
"'Sommernachtstraum" angesiedelt. Nur merkte man auf dem Bildschirm nicht viel davon, denn die Dialoge waren
Papier, die Dekoration Pappe. Zwar hatte auch diese sechste und letzte Shakespeare-Komödie aus Berlin ihre Glanzpunkte.
Das waren die Rüpelszenen mit Hans Hessling an der Spitze. Auch konnte man den
"Puck" von Renate Danz gelten lassen,
der ausgelassen seine Spiele trieb. Aber die Verzauberung blieb aus, und das ist schade für die vielen Menschen, die den
"Sommernachtstraum" (weil sie ihn nur vom Bildschirm kennen) zeitlebens für ein langweiliges Stück halten werden. (SFB)
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))
→ IMDb
- 1958: Die Bürger von Calais (nach dem gleichnamigen
Schauspiel von Georg
Kaiser; R: Frank Lothar (1916–?);
als Jean de
Vienne (Jean de Fiennes),
1. der gewählten Bürger; Kurzinfo: Der
englische König Eduard III. verspricht der
belagerten Stadt Calais Schonung, wenn sich sechs seiner Bürger im Büßergewand zur Hinrichtung stellen. Einer
der reichsten, Eustache
de Saint Pierre (Friedrich Maurer), opfert sich als erster …
"Gong"
(42/1958): Georg Kaiser, dessen 80. Geburtstag näher rückt und dessen 1917 in
Frankfurt a.M. uraufgeführtes
Bühnenspiel "Die Bürger von Calais" in der kriegerischen Epoche der einhundertjährigen englisch-französischen
Auseinandersetzung spielt, stellt den
"neuen Menschen", wie ihn der Expressionismus proklamierte, in den Mittelpunkt.
Georg Kaiser erhielt zu dem dramatischen Thema wohl die Anregung von Rodins berühmten
Denkmal. Der Bildhauer
hat den Bürgern von Calais ein Monument geschaffen. Diese Bürger sind auch die Helden der Dichtung, die Frank Lothar
für das Fernsehen bearbeitet und in Szene gesetzt hat.
"Gong" (45/1958) schrieb in seiner Kritik: Eine der größten Enttäuschungen der letzten Monate bereitete uns Frank Lothar,
(…). Zugegeben: Kaisers Stil für das Fernsehen, das zum Psychologisieren und zum Illusionismus verleitet, umzuformen
und neu zu beleben, ist nicht ganz leicht. Lothar schaffte es nicht. Das lag nicht allein an den Darstellern, sondern in
erster Linie an der Auffassung des Regisseurs, der sie mit langweiliger Feierlichkeit über die Szene stelzen ließ und
ihnen ein Pathos aufdrängte, das alle echten Gefühlsausbrüche erstickte und keine Höhepunkte mehr zuließ. Auch die
Choreografie ließ jede Dynamik vermissen. Wenn sich jemand bewegte, wo war es allenfalls noch die Kamera, die sich
im übrigen aber in übertriebenen Großaufnahmen erschöpfte. Übrig blieb eine Inszenierung, die das Niveau einer
respektablen Laienspiel-Aufführung erreichte.
"Hörzu"
45/1958) schrieb in ihrer Kritik: Für das Hauptwerk Georg Kaisers hatte das Fernsehen 50 Minuten übrig (…).
Was von Kaisers Stück blieb, war ein abgenagtes Gerippe. Das Wort des blinden, greisen Eustache:
"Ich habe den
neuen Menschen gesehen!" musste den Zuschauer verwundern. Denn ihm war der
"neue Mensch" verborgen geblieben.
"Hören
und Sehen" (46/1958) schrieb in ihrer Kritik: (…) das auch auf dem Bildschirm recht wirksam wurde.
Regisseur Frank Lothar hatte vernünftig gestrichen und entstaubt. Er hatte dabei aber die beiden einzigen Frauenrollen
verschwinden lassen. So sah man sich nur vielen Männern gegenüber, nicht ganz gleichwertigen Schauspielern allerdings,
die etwas zu oft in Großaufnahme agierten. Trotz dieser Einschränkung ein Abend, der sicher vielen Fernsehern gefallen
hat. (SFB)
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))
→ IMDb
- 1959: Der Kaiser von Amerika (nach der Komödie "The Apple Cart"
von George
Bernard Shaw;
Inszenierung: Berliner "Renaissance-Theater";
R: Willi
Schmidt; mit O. E. Hasse als König Magnus;
als Handelsminister Boanerges) → IMDb;
siehe auch Info
zum Hörspiel (EA: 19.02.1959)
- 1959: Affäre Dreyfus (nach
dem Theaterstück "Die Affäre Dreyfus" von Hans
José Rehfisch und Wilhelm
Herzog
über die Dreyfus-Affäre;
R: Hanns
Farenburg;
als der Historiker und Politiker Jean
Jaurès)
- 1959: Ruf ohne Echo
(nach dem Roman "Les saints vont en enfer" ("Die
Heiligen gehen in die Hölle") von
Gilbert-Pierre Cesbron (1913–1979); R: Rainer
Wolffhardt; als Gemeindepfarrer)
- 1961: Stahlnetz
(Krimiserie; als Polizeimeister Henri Wohlers in Folge 13 "Saison")
- 1962: Leben des Galilei (nach dem
gleichnamigen
Theaterstück von Bertolt
Brecht; R: Egon
Monk; mit Ernst Schröder
als
Galileo
Galilei;
als Herr Priuli, Kurator der Universität in Padua)
- 1962: Die Soldaten (nach dem
gleichnamigen
Trauerspiel von Jakob Michael Reinhold
Lenz; R: Harry Buckwitz;
als Herr Wesener, Galanteriehändler in
Lille;
Edith
Schultze-Westrum als dessen Ehefrau), Eltern von
Marie (Beatrice Schweizer) und Charlotte (Marie-Luise Hengherr))
- 1963: Man kann nie wissen
(nach
der Komödie "You Never Can Tell"
von George
Bernard Shaw; R: Dietrich Haugk;
als der wohlhabende,
von seiner Frau, nunmehrige Frau Clandon (Ursula von Reibnitz)
getrennt lebende britische
Reeder McNaughton,
Vater von Dolly (Sabine
Sinjen), Gloria (Christa Bernhardt) und Phil (Volker
Lechtenbrink)
"Gong"
38/1963: Im Thema überholte Komödie (1898) des irischen Spötters; durch spielerische Bosheiten und durch
scharfe Charakterzeichnung heute noch unterhaltsam. Ab 16
"Hamburger Abendblatt"
(23.09.1963):
Diese seit ungezählten Jahrzehnten in den Bühnenarchiven schmorende,
von der Zeit überrollte Komödie Bernard Shaws hat zuviel Staub angesetzt, als dass man ihre Wiederausgrabung für
den Bildschirm noch gutheißen könnte. Regisseur Dietrich Haugk hat das natürlich gewusst und versucht, das Spiel
seines trefflich besetzten Ensembles durch Einfügung buffoesker Elemente aus der
Commedia dell'Arte schmackhaft
zu machen. Schwäche der Handlung und Langatmigkeit der Dialoge erschöpften aber vorzeitig Neugier und Geduld
es Zuschauers.
"Gong" (41/1963): Die aparte
Komödie gehört nicht zu den stärksten Arbeiten von G. B. Shaw, (…).
Die Problematik
des Stücks, hie konservative, da fortschrittlich-emanzipierte Gesinnung
als tragischer Ehekonflikt, ist längst nicht
mehr aktuell, aber die geistsprühenden und so viele menschliche
Schwächen entlarvenden Dialoge Shaws fesseln ein
Publikum allemal und unterhalten es liebenswürdig-amüsant. Die
Inszenierung gefiel uns, wenn man auch bemerkte,
dass dem Regisseur der Bildschirm noch ein wenig fremd ist. Wohl wissend
um die verstaubte Problematik, verzichtete
Haugk auf dezenten Kammerspielton und ließ das glänzend
zusammengestellte Ensemble sich voll ausspielen.
Sabine Sinjen z. B. sahen wir lange nicht mehr so temperamentvoll
agieren.
"Hörzu"
(41/1963): Bei Shaws "Man kann nie
wissen" gelang die Neubelebung nur mäßig. Die Zeit vor der
Jahrhundertwende, aus deren Geist das Stück entstanden ist, wurde durch allerlei unstimmigen Ulk ironisiert.
Dadurch verlor das Ganze den Boden unter den Füßen, es spielte weder heute noch gestern und feuerte seine
Pointen und Thesen ins Leere (SDR).
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))
- 1963: Eine schöne Bescherung
(nach
der Komödie "La cuisine des anges" von Albert Husson (1912–1978);
R: Klaus Wagner (1930–2011); als Felix Ducotel, Ehemann von Amelie
(Heli
Finkenzeller), Eltern von
Isabelle (Margot
Philipp); Kurzinfo: Jules (Gustav
Knuth), Josef (Günther
Jerschke) und Alfred (Udo
Vioff) sind
Sträflinge auf der französischen Gefangeneninsel Cayenne. Am Nachmittag vor dem Weihnachtsfest sollen sie
das Dach des ansässigen Kaufhauses Ducotel reparieren. Mit überraschenden Fähigkeiten und den Giftzähnen ihres
Talismanes,
der Schlange Adolphe gelingt es den drei, Schicksal im Hause Ducotel zu spielen. Dem allzu
gutmütigen Hausherren
droht nämlich durch seinen Schwager der Verlust von Kaufhaus und Wohnung.
Der speziellen Fürsorge der drei
Gauner ist es auch zu verdanken, dass sich die junge Isabelle ihren Traum
von der großen Liebe erfüllen kann …:
"Gong"
(25/1963): Albert Husson treibt in dieser Komödie ein amüsantes und nachdenkliches Spiel mit der
melancholischen Wahrheit, dass die Güte der Menschen nicht immer mit der Höhe ihres Bankkontos übereinstimmt,
noch ihre Bosheit mit den Daten der Strafakten. – Groteske, Spielzeit um das Jahr 1880, mit schwarzem Sträflingshumor
und nicht ganz ernstgemeintem mörderischem Einschlag. Für Erwachsene (HR).
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com))
→ Verfilmung
1955
- 1964: Der Arzt wider Willen (nach der Komödie
"Le
médecin malgré lui" von Molière;
R: Korbinian Köberle;
als Géronte, Vater der
Lucinde (Heidelotte Diehl))
- 1965: Ein Volksfeind (nach dem
gleichnamigen
Schauspiel ("En Folkefiende") von Henrik
Ibsen, in der Bearbeitung
von Arthur
Miller; R: Oswald Döpke; mit
Wolfgang Büttner als Badearzt Dr. Thomas Stockmann;
als
Zeitungsherausgeber Aslaksen)
- 1965: Ninotschka
(Musical von
Oliver Hassencamp
nach der gleichnamigen Komödie von Menyhért
Lengyel;
R: Imo Moszkowicz;
mit Ruth
Leuwerik in der Titelrolle; als Genosse Bibinski) → siehe
auch
Kinofilm 1939
sowie
Kinofilm 1959
- 1965: Der Gärtner von Toulouse (nach dem Schauspiel von Georg
Kaiser; R: Falk
Harnack; als Stellenvermittler Quechartre
Kurzinfo: Der junge Francois (Hinrich Rehwinkel) möchte Gärtner werden, weil nur die Pflanzen
seinen strengen
Anspruch auf Reinheit erfüllen. Eine Stellung als Gärtner erhält er jedoch nur, wenn er verheiratet ist.
So gibt er kurzerhand eine junge Frau aus dem Vorzimmer des Stellenvermittlers als seine Gemahlin aus und ehelicht
Janine (Elfriede
Irrall), ohne zu ahnen, dass sie eine Dirne ist. Ihr gemeinsames Leben im Glashaus verläuft unbeschwert,
bis die neue Herrin, Frau Téophot (Lola Müthel) auftaucht. Sie ist die ehemalige Chefin Janines, verführt den jungen
Gärtner und klärt ihn über die Vergangenheit seiner Frau auf. Francois tötet die Herrin und zwingt seine Frau, die Tat
auf sich zu nehmen …
"Funk
Uhr" (21/1965): Georg Kaiser, der zu den bedeutendsten Dramatikern des Expressionismus zählt und das
nationalsozialistische Deutschland verlassen musste, starb wenige Wochen nach Kriegsende: am 6. Juni
1965 jährt sich sein
Todestag zum zwanzigsten Male. 1938 schrieb Kaiser in Amsterdam unter dem Titel
"Der Gärtner von Toulouse" eine
phantastisch-überhitzte und doch kühl konstruierte, moderne, poetisch-dramatische Paraphrase zum Sündenfall der biblischen
Genesis.
"Gong"
(21/1965): Poetisch-dramatisches Schauspiel über die Verfügbarkeit und Schuld eines jungen, sich liebenden Paares.
Nur für Erwachsene.
"Hamburger Abendblatt"
(29.05.1965): Wenn auch Regisseur Falk Harnack die vom Vorbild der Klassiker
Lessing,
Lenz
und Büchner geprägte, das heißt alles Naturalistische abstreifende Bühnensprache Georg Kaisers durch Rücknahme des
tonlichen Ausdrucks den Erfordernissen des Fernsehspiels hörbar anzupassen versuchte: Der Zuschauer blieb
kühl
Das dramatisch zu Ende gedachte Finale, dem Munde des Gärtners anvertraut, überzeugte nicht, weil der junge
Hinrich Rehwinkel dieser Erzengel- und Todesbotenfiguration noch nicht gewachsen ist. Auch Elfriede Irrall hatte in
der Rolle der Janine keinen leichten Stand: Was man ihr nicht abnahm, war die so billige wie willige Dirne aus dem Maison
der Madame Téophot, die freilich von Lola Müthel mit allem Raffinement der erfahrenen Lebedame ausgestattet wurde.
Sie und Hans Hessling als betriebsamer Stellenvermittler Quechartre wurden mit des Dichters gebauter Sprache noch
am besten fertig. Es wird – anders als auf der Bühne – schwer sein, diesem Dichter des deutschen Expressionismus auf
dem Bildschirm zu voller Wirkung zu verhelfen.
"Gong" (25/1965): (…) Georg Kaiser, der in den Jahren zwischen 1913 und 1922 mit 21 Uraufführungen einen deutschen
Theaterrekord aufstellte, hat man heute fast vergessen. Die höhere Kritik bescheinigt diesen Stücken mangelnde Vitalfunktion.
Seinem ("Gärtner von Toulouse") wird jedoch niemand Lebenskraft und dramatischen Atem absprechen wollen.
Diese Paraphrase über den Sündenfall ist weder sprachlich revolutionär, will sagen vom wilden Kurzschrift-Stakkato des
Schaffens der zwanziger Jahre gezeichnet, noch inhaltlich "gewagt". (…)
Dr. Falk Harnack (…) schöpfte die dramatische
Vehemenz und den Stimmungsgehalt seiner Vorlage nicht einmal aus. Das Stück verblasste zum Traktat über die böse Lust.
Triebhaftigkeit und Treibhausatmosphäre wurden sittsam unterspielt. Die moralistischen Züge des Stücks traten dabei um
so deutlicher hervor. Das mag im Sinne der Mainzer Auftraggeber opportun gewesen sein, vom Werk und seiner Wirkung
aus gesehen war es dennoch falsch. Bei anderer Führung hätte zumindest eine Schauspielerin wie Lola Müthel (Frau Téophot)
weit stärkere Schwingungsgrade erreichen können. Doch es hat offenbar nicht sein sollen.
(Quelle:
tvprogramme.shoutwiki.com)) → IMDb
- 1965: Die chinesische Mauer
(nach
der gleichnamigen
Farce
von Max Frisch;
R: Hans Lietzau;
als Zeremonienmeister Da Hing Yen) → Die Krimihomepage
(Spezial),
filmportal.de
- 1967: Der Revisor
(nach der
gleichnamigen
Komödie
von Nikolai Gogol;
R: Gustav Rudolf Sellner;
als Gutsbesitzer
Pjotr Iwanowitsch Dobtschinski; mit Hans Clarin als der Petersburger Beamte Chlestakow)
→
IMDb
- 1967: Die Mission
(nach
dem Roman über die Konferenz
von Évian von Hans
Habe; R: Ludwig
Cremer; als Megelein;
Kurzinfo: Auf Intention von US-Präsident Roosevelt treffen sich im Sommer 1938 Delegierte aus 32 Ländern, um im
französischen Badeort Evian-les-Baines bei
Genf darüber zu beraten, wie man den Juden und den anderen Verfolgten
des Nazi-Regimes helfen könnte. Auch der
Heilige Stuhl und jüdische Hilfsorganisationen haben Vertreter geschickt.
Unter den Teilnehmern ist der jüdische Wiener Chirurg Professor Heinrich von Benda
(Martin
Held). Im Auftrag des
Reichsstatthalters in Österreich,
Seyss-Inquart
(Richard
Münch), soll Benda den Politikern inoffiziell einen
ungeheuerlichen Vorschlag unterbreiten: Die Nazis wären für einen
"Stückpreis" von 250 Dollar bereit, dem Ausland
die Juden zu verkaufen, anderenfalls würde man dieses wertlose Menschenmaterial vernichten. Bendas schreckliche
Mission löst viele Missdeutungen aus, lässt ihn als Juden erscheinen, der mit den braunen Machthabern paktiert.
Nach endlosen fruchtlosen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen – unter anderem mit amerikanischen und
jüdischen Vertretern :– muss der Professor entsetzt feststellen, dass jede Nation ihre Gründe vorzubringen weiß,
um den "Ankauf" abzulehnen. Aus Mangel an Vorstellungskraft und aus Trägheit des Herzens nimmt kaum einer
die Drohung der Deutschen ernst …
Das Fernsehspiel entstand nach dem gleichnamigen Roman von Hans Habe. Der Autor hat selbst als Korrespondent
des "Prager
Tagblattes" an der Konferenz teilgenommen. Während das Buch in der Schilderung des Verhandlungsverlaufes
authentisch ist, hat Habe das Schicksal des Arztes, der eigentlich Heinrich Neumann(→ deutsche-biographie.de) hieß,
frei gestaltet.
"Hamburger Abendblatt"
(31.03.1967): (…) Diese Münchner Intertel-Produktion bot sich in meisterlich geführten
Dialogszenen und großartiger Besetzung als atemberaubendes und erschütterndes Dokumentarspiel von der Unfähigkeit
der Mächte, einer sich eindeutig ankündigenden Massenvernichtung bezeiten Einhalt zu gebiebeten.
"Gong" (17/1967): (…) als Fernsehspiel ist so ein höllisches Angebot mitten im Frieden von romanhaften Zügen
mitgeformt, die Überzeugung liegt hier mehr beim Schauspieler (auch dank der großen, überragenden Gestaltungskraft
von Martin Held als von Benda) als im Dokumentarspiel. Durch die große Besetzung (auch Chargenrollen waren
mit bedeutenden Schauspielern besetzt) gelang dem Regisseur Ludwig Cremer eines der besten Fernsehspiele der
neuen Saison.
"Hörzu"
(16/1967): (…) Der Schock blieb hier aus. Wie meist bei Dokumentarspielen, die die Wirklichkeit nicht zugunsten
künstlerischer Freiheit verändern können. Es bleiben Akten, Protokolle. Und Protokolle sind nun mal nüchtern und
langweilig. In Erinnerung behält man nicht das Stück, sondern nur die Reife Leistung von Martin Held (ab 16 /
BR))
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com)
→ wunschliste.de
- 1969: Troilus und Cressida (nach dem gleichnamigen
Drama von William Shakespeare;
Inszenierung:
"Ruhrfestspiele
Recklinghausen"; Regie: Heinrich
Koch; TV-Regie: Hans
Quest; mit Gerd Seid
(Troilus),
Christine Wodetzky
(Cressida); als Cressidas Onkel Pandarus) → IMDb
- 1970: Vor Sonnenuntergang (nach dem
gleichnamigen
Schauspiel von Gerhart
Hauptmann; R: Wolfgang Glück;
mit Werner Hinz (Matthias Clausen) und
Cordula Trantow (Inken
Peters); als Pastor Immos)
- 1971: Der Schlafwagenkontrolleur
(nach der Komödie "Le
contrôleur des wagons-lits" von Alexandre
Bisson;
R: Heinz
Schirk; mit Alfred Böhm
als Monsieur Georges Godefroid, der seiner Familie vormacht, er sei
Schlafwagenkontrolleur,
um seine Geliebte Rosine (Franziska
Oehme) ungestört besuchen zu können, Klaus Havenstein als der echte
Schlafwagenkontolleur Alfred Godefroid; gemeinsam mit Else Quecke als Monsieur und Madame Charbonneau,
Eltern von Rosine) → IMDb
- 1971–1981: Tatort
(Krimireihe)
- 1972/1973: Kleinstadtbahnhof
/ Neues vom Kleinstadtbahnhof (Serie
mit Heidi Kabel und
Gustav Knuth;
als Bahnhofsvorsteher Arnold Pollmann)
- 1972: Dem Täter auf der Spur
(Krimiserie; R: Jürgen Roland)
→ Wikipedia
- 1973: Lokaltermin
(Krimiserie mit Hans
Söhnker als Amtsrichter Schröter; als Staatsanwalt in Folge 10 "Auf die Minute")
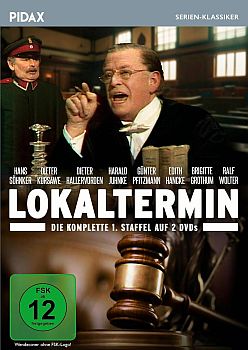 |
 |
"Lokaltermin":
Abbildung DVD-Cover
sowie Szenenfoto
(v.l.n.r.) aus Episode 10
mit Hanns Hessling
(Staatsanwalt),
Dieter Kursawe
(Gerichtsschreiber Wutzke),
Hans Söhnker
(Amtsrichter Schröter)
Mit freundlicher Genehmigung
von Pidax Film,
welche die Serie
am 9. August 2024
auf DVD herausbrachte. |
- 1974: Die preußische Heirat
(nach dem Theaterstück "Zopf und Schwert" von Karl Gutzkow,
welches nicht die Beziehung
zwischen dem jungen Friedrich von Preußen
(Gerd Böckmann)
und seinem Vater Friedrich Wilhelm I.
(Carl
Raddatz),
dem strengen "Soldatenkönig" bedient; R: Helmut Käutner;
als General Friedrich
Wilhelm von Grumbkow;
Kurzinfo: Preußen im 18. Jahrhundert: Friedrich Wilhelm I. (Carl Raddatz), genannt der
"Soldatenkönig", ist für
seine Rauheit und Strenge bekannt. Als seine Gemahlin Königin Sophie
Dorothea (Dagmar
Altrichter) ihre
gemeinsame Tochter Wilhelmine (Claudia Butenuth) mit dem Prinzen von Wales vermählen will, weiß er dies energisch
zu verhindern. Dem Willen des Vaters nach muss Wilhelmine den Erbprinzen von Bayreuth
(Edwin
Noël) heiraten …
(Quelle: Pidax
Film)) → filmmuseum-potsdam.de,
fernsehserien.de
- 1975: Beschlossen
und verkündet (Serie, Fortsetzung von "Lokaltermin"
mit Hans
Söhnker als Amtsrichter Schröter;
als Staatsanwalt Arndt in 04. "Der ehrliche Finder"/06.
"Jean"/07. "Geisterhände")
 |
 |
"Beschlossen und verkündet":
Szenenfoto (v.l.n.r.) aus
Episode "Geisterhände"
mit Harald Juhnke
(Herr Katt),
Hanns Hessling
(Staatsanwalt Arndt),
Harald Leipnitz
(Verteidiger Tramp),
Franz-Otto Krüger
(Oberstudiendirektor Dr. Ickel),
Hans Söhnker
(Amtsrichter Schröter)
Mit freundlicher Genehmigung
von Pidax Film,
welche die Serie
am 30.10.2024
auf DVD herausbrachte. |
- 1975: Hoftheater
(Serie;
R: Herbert Ballmann;
mit Theo Lingen als Hoftheater-Intendant Baron von Krombholz;
als Ensemble-Mitglied Schauspieler Claudius Lembke) → fernsehserien.de
- 04. Der Dolch der Kleopatra
- 05. Gastspiel auf Engagement
- 08. Der Spion, der von der Bühne kam
- 09. Warum weinen Sie, Mörder Müller?
- 10. Die Ordensverleihung
- 1977: Heiße Ware (R:
Imo
Moszkowicz; mit Klaus Wildbolz als
Gentleman-Dieb Cassidy; als Bracken)
- 1977: Es muss nicht immer Kaviar sein (Serie
nach dem gleichnamigen
Roman von Johannes
Mario Simmel;
R: Thomas
Engel; mit Siegfried Rauch als der Frauenliebhaber und Hobbykoch Thomas Lieven;
Marisa Mell in 6 Episoden als Lievens Geliebte Chantal;
als Dr. Boule)
- 1977: Der Heiligenschein (aus der Reihe "Liebesgeschichten"
nach einer Kurzgeschichte
von Curt Siodmak;
R: Heinz Schirk;
als Pater Bruno) → IMDb
- 1979: Timm
Thaler (Serie nach dem Roman "Timm
Thaler oder das verkaufte Lachen" von James
Krüss;
R: Sigi
Rothemund; mit Thomas
Ohrner als Timm Thaler; in 2 Folgen (12. "Der
Vertrag"/13. "Der
Kampf um das Lachen")
als Bischof) → Wikipedia
- 1981: Derrick
(Krimiserie mit Horst
Tappert; als Herr Winter in Folge 85 "Das sechste Streichholz")
- 1981: Ein
Zug nach Manhattan (nach der Geschichte "Holiday Song"
von Paddy
Chayefsky; R: Rolf
von Sydow;
mit Heinz
Rühmann als der jüdische Kantor Leon Sternberger, der seinen
Glauben an Gott verliert;
als dessen bester Freund Mosche Rosen)
- 1981: Das Haus im Park
(R:
Aribert
Weis; mit Wilfried Labmeier als der kleine Gauner Andi Höffner;
als Hochschulprofessor) → filmdienst.de
- 1981: Preußische
Nacht (R: Oswald
Döpke; als Hans
Joachim von Zieten, enger Vertrauter Friedrich
II. (Gerd Böckmann))
- 1981: Die Fahrt nach Schlangenbad
(R:
Stanislav Barabáš;
als Strunk) → Murnau Stiftung
- 1982: Die Präsidentin
(nach dem Schwank "La présidente" um eine falsche
Gerichtspräsidentin von Maurice Hennequin
und
Pierre Veber (1869–1942); R: Michael Günther;
mit
Heinz Schubert
als der mit Aglae (Bruni
Löbel) verheiratete,
sittenstrenge Gerichtspräsident Tricaut; Gaby Gasser
als die Tinteltangel-Sängerin Gobette; als der Justizbeamte Marius)
- 1982: Betti,
die Tochter (R: Heinz
Schirk; mit Claudia Schermutzki als die 17-jährige Betti;
als Friedrich)
- 1983: Ein
Fall für zwei (Krimiserie; als Rentner in Folge 16 "Herr
Pankraz, bitte!"; mit Günter
Strack (Dr. Dieter Renz)
und Claus
Theo Gärtner (Privatdetektiv Josef Matula))
- 1983: Der
Trotzkopf (8 Teile nach dem gleichnamigen
Roman
von Emmy von Rhoden;
R: Helmuth
Ashley; mit Anja Schüte
in der Titelrolle der Ilse Macket; als Pfarrer Wollert,
Freund der Familie Macket) → Wikipedia,
fernsehserien.de
- 1983: Zwei Tote im Sender und Don Carlos im Pogl
(R: Joachim
Roering; als Kritiker und Schauspieler "Prinz Ebolus")
- 1985: Mein Freund Harvey (nach der gleichnamigen
Komödie von Mary
Chase; R: Wolfgang
Spier; mit Harald
Juhnke
als Elwood P. Dowd; als Anwalt Gaffney) → IMDb
- 1987: Sturmflut
(Dokumentarspiel über die
Hamburger Sturmflut
des Jahres 1962; R: Lutz
Büscher; als Opa Labmann) → IMDb
- 1987: Der
Landarzt (Serie; als der alte Bauer Gustav Plötsch in
Staffel 1 mit Christian
Quadflieg als Dr. Karsten Mattiesen)
- 1988: Die letzte Fahrt der San Diego
(R: Oswald Döpke; als
Wilhelm; spiegel.de:
"Ein verwitterter Fahrensmann
Unsympath vom Dienst: Siegfried
Wischnewski), der im Alter eine Pension betreibt, wird ermordet aufgefunden.
Auf der Suche nach dem Täter entdeckt die Familie immer mehr dunkle Flecken in der Vergangenheit des alten Käptn.")
- 1990–1993: Der Millionenerbe
(12-teilige
Serie
mit Günter
Pfitzmann; in 9 Folgen als der reiche Schmuckhändler
Ludwig Rimbach, Vater von Irene (Evelyn
Hamann))
- 1991: Der Hausgeist
(Serie;
als Antiquar Vogelsam) → zauberspiegel-online.de,
fernsehserien.de
- 1991: Großstadtrevier
(Krimiserie; jeweils ungenannte Rolle)
|
|