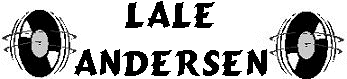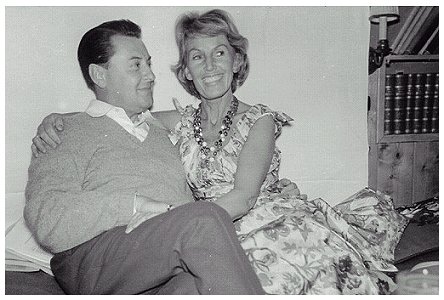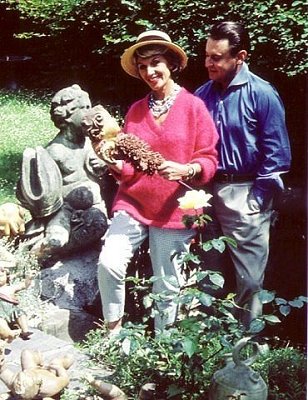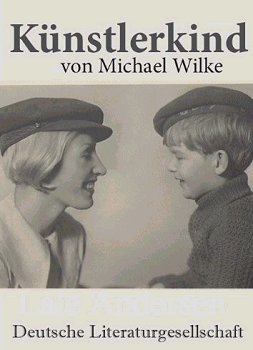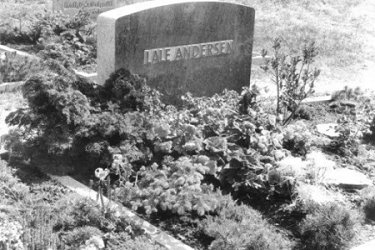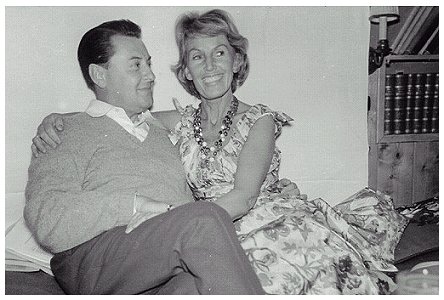 |
Sobald Lieselotte Wilke in Berlin Fuß
gefasst hatte, wollte sie ihre Kinder zu sich holen.
Noch im selben Jahr – die Ehe mit Paul Ernst Wilke war
inzwischen geschieden worden – trat sie (noch als Liselott Wilke)
erstmals am "Deutschen Künstlertheater"1) in Berlin auf,
Verpflichtungen an
verschiedenen Berliner Bühnen schlossen sich an. Doch der Karrierestart
gestaltete sich anfangs mühsam, erst mit den Jahren gelang
Lale Andersen, wie sie sich ab Mitte der 1930er nannte, der Durchbruch zur populären
Künstlerin, vor allem aber Sängerin.
Lale Andersen 1953 mit ihrem zweiten Ehemann, dem Schweizer
Liedkomponisten Artur Beul1) (1915–2010) in ihrem
Domizil in Zollikon1)
Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul
gezeigt werden;
die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)
© Artur Beul |
1933 erhielt sie ein Engagement am "Schauspielhaus Zürich"1), wo sie den
Komponisten und (späteren Intendanten) Rolf Liebermann1)
(1910 – 1999) kennen und lieben lernte und
zwischen 1933 und 1937 mit kleinen Rollen auf der Bühne stand. Danach
wechselte sie zu Kleinkunst- und Kabarettbühnen, trat unter anderem
beim Berliner "Kabarett der Komiker"1)
und im Münchner Kabarett "Simpl"1)
als
Chansonsängerin auf. International berühmt wurde
sie mit dem Soldatenlied "Lili Marleen"1), das sie am
1./2. August 1939 erstmals mit einem Orchester
unter Leitung von
Bruno Seidler-Winkler1)
in den Berliner "Electrola"1)-Studios
aufnahm und damit für den ersten Millionenseller in der deutschen Schallplattengeschichte
sorgte. Das Lied war keine
"Erfindung" der 1930er Jahre, sondern bereits 1915 von
dem 1893 in Hamburg geborenen, jungen Soldaten Hans Leip1)
(† 1983) für seine
Freundin verfasst worden, der damit das Leid eines durch den 1. Weltkrieg
getrennten Paars thematisierte. Bei ihm hieß das Gedicht "Lied eines jungen
Wachtposten", die Musik stammte von dem 1911 in Braunschweig
geborenen Norbert Schultze1)
(† 2002), der den melancholischen Text 1938 erneut vertonte. Von
der veröffentlichten Schallplatte wurden gerade einmal 700 Exemplare verkauft
und zunächst geriet die Produktion in Vergessenheit.
1941 übernahm der "Soldatensender Belgrad"1)
die unheroische, sentimentale Ballade um 22:00 Uhr allabendlich als Sendeschluss-Melodie, der Song – und damit auch
Lale Andersen – geriet nicht nur bei den deutschen Soldaten
zum Knüller, sondern auch auf englisch-amerikanischer Seite, die Sängerin selbst wurde von dem Erfolg
dieser inoffiziellen Antikriegs-Hymne völlig
überrascht. Das melancholische Lied, welches die Geschichte von der
Soldatenbraut, die "vor der Kaserne, vor dem großen Tor" unter
einer Laterne auf die Heimkehr ihres Liebsten aus dem Krieg wartet, passte mit
seinem Text eigentlich nicht zu der in jener Zeit üblichen Durchhalte- und
Kriegspropaganda, doch selbst der Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels1)
schaffte es nicht, "Lili Marleen" aus dem Rundfunkprogramm zu
verbannen. Goebbels nannte das Werk damals das "Lied mit dem
Totentanzgeruch", da es die Soldaten nicht zum kämpfen ansporne, sondern
nur heimwehkrank mache, und untersagte der Künstlerin unter Androhung der
Ausweisung das Lied wegen der "wehrkraftzersetzenden Wirkung" weiter zu singen. Lale Andersen selbst wurde
zeitweilig mit
einem Auftrittsverbot belegt, das Goebbels jedoch 1943 aufgrund der
enormen Popularität der Sängerin nach neun Monaten wieder aufheben musste.
Allerdings
erhielt Lale Andersen eine Reihe von Auflagen, "Lili Marleen"
durfte sie weiterhin nicht singen und es wurde ihr nur gestattet, bei privaten
Veranstaltern aufzutreten , von denen es zu der Zeit nicht allzu viele gab.
Wikipedia notiert: "Aufgrund der erzwungenen Inaktivität Andersens
entstand die Falschmeldung der BBC1),
sie sei in ein Konzentrationslager
eingewiesen worden. Hierdurch sahen sich die Nationalsozialisten zu einem Dementi
genötigt und ließen Andersen wieder öffentlich auftreten. Ihr blieb jedoch
untersagt, "Lili Marleen" zu singen. Im Mai 1943 wurde ihr
Auftrittsverbot gelockert, doch blieb es ihr verboten, vor Soldaten zu singen
oder sich in irgendeiner Weise mit ihrem Erfolgslied in Verbindung zu bringen.
Stattdessen hatte sie sich laut Anordnung der "Reichskulturkammer" für das
"Propagandaministerium" bereitzuhalten, um für die so genannte
"Rundfunkpolitische Abteilung" englische Schallplatten ("Propagandajazz")
einzusingen."
Für
die US-amerikanischen Soldaten wurde das Lied ab 1944 übrigens in Englisch
von Marlene Dietrich
interpretiert und der Evergreen soll bis heute in
48 Sprachen übersetzt worden sein.
Kurz vor Kriegsende floh Lale Andersen mit ihrem jüngsten Sohn
Michael auf die
Nordsee-Insel Langeoog1) und
blieb dort bis zur Übernahme der Insel durch die kanadische Armee. Nach
Ende des 2. Weltkrieges wurde es stiller um die
Künstlerin, sie schien aus der deutschen Schlagerlandschaft verschwunden zu
sein, doch ab Mitte der 1950er Jahre konnte sie an ihre einstige Popularität
anknüpfen.
|
1949 heiratete sie den Schweizer Liedkomponisten Artur Beul1) (1915 – 2010), der
rund zwanzig Erfolgslieder für Lale Andersen schrieb, darunter "He,
hast du Feuer, Seemann", Liselott aus Bremenhaven", "Die
Fischer von Langeoog" und "Mit zwei Augen wie den Deinen". In
der von Paul Verhoeven
mit Marianne Hold und
Adrian Hoven
gedrehten, stimmungsvollen Liebesromanze "… wie
einst, Lili Marleen"1) (1956) sang sie natürlich
den Erfolgsschlager "Lili Marleen"
sowie den Titel "Südseenacht". Der Song "Ein Schiff wird kommen"1),
die deutsche Coverversion des Schlagers "Ta
pedia tou Pirea"1) von Manos Hadjidakis1), der in dem
Kinofilm "Sonntags… nie!"1) (1960,
"Never on Sunday")
von Melina Mercouri interpretiert.wurde, geriet über Nacht zum Kassenschlager, rückte in der Hitparade bis auf
Platz 1 vor und Lale Andersen erhielt am 3. März 1961 auf dem
Luxusdampfer
"United States"1) den
"Löwen
von Radio Luxemburg"1) in Silber als "beliebteste deutsche Schlagersängerin
des Jahres 1960"; in den US-Charts erreichte die Nummer immerhin
Platz 88. Beim "6. Grand Prix
Eurovision de la Chanson"1)
(heute "Eurovision Song Contest") vertrat sie Deutschland am 18. März 1961 in
Cannes1) mit dem deutsch-französisch
gesungenen Lied "Einmal sehen wir uns wieder"1), das jedoch nur den
13. Platz (von 16) erringen konnte → "Eurovision Song Contest 1961".
Lale Andersen und ihr Ehemann
Artur Beul1) (1915–2010)
in ihrem Garten in Zollikon1)
Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul
gezeigt werden;
die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch);
© Artur Beul
|
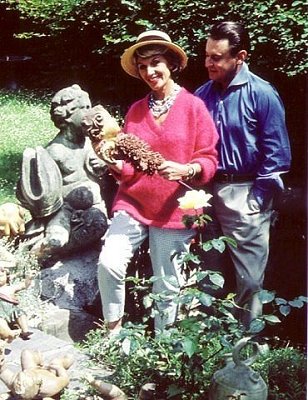
|
 |
Lale Andersen war wieder ein viel gefragter Plattenstar, aber vornehmlich
auf Seemanns-Lieder festgelegt. Mit Aufnahmen wie dem bereits 1942
veröffentlichten Tangolied "Unter der roten Laterne
von St. Pauli"1) oder dem
Schlager "Blaue Nacht am Hafen"1)
(1951), der Coverversion von "Jealous Heart"1), erhielt sie
weitere "Goldene
Schallplatten"1); zu letzterem
schrieb sie selbst den Text unter dem Pseudonym "Nicola Wilke".
Titel wie "Blaues Meer" (1961),
"In Hamburg sind die Nächte lang" (1964) oder "Der
Rummelplatz am Hafen" (1963) verkauften sich millionenfach, in den
letzten Jahren wandte sie sich dann verstärkt dem plattdeutschen Volkslied zu.
Die Künstlerin ging auf unzählige Konzertreisen, die sie verstärkt auch ins
Ausland führten, sie trat erfolgreich in zahlreichen Fernseh-Shows wie in der
beliebten "Haifischbar"1) auf und übernahm auch gelegentlich Aufgaben
als Schauspielerin in TV-Produktionen wie in dem von Jürgen Roland1)
nach dem Roman von Hansjög Martin1)
gedrehten Krimi "Einer
fehlt beim Kurkonzert"1) (1968), wo sie
die Agathe Brocksiepen mimte, deren Schwester
Hilde (Karin Hardt)
schließlich als Giftmörderin entlarvt wird. In dem TV-Film "Der
Pott"3) (1971), von Peter Zadek1) in
Szene gesetzt nach der Tragikomödie "Der Preispokal"4) ("The Silver Tassie")
von Sean O'Casey1) in
der Übersetzung von Tankred Dorst1), trat sie als
Truppenbetreuerin in
Erscheinung → Übersicht Filmografie.
Foto: Lale Andersen und ihr Ehemann Artur Beul1) (1915–2010)
Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul
gezeigt werden;
die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)
© Artur Beul
|
|
Darüber betätigte sich Lale Andersen auch als Schriftstellerin, 1969 erschien "Wie werde ich Haifisch? – Ein
heiterer Ratgeber für alle, die Schlager singen, texten oder komponieren
wollen." 1972, kurz vor ihrem Tod, stellte sie ihren
autobiographischen Lebensroman "Der Himmel hat viele Farben – Leben
mit einem Lied" der Öffentlichkeit vor. Die Erinnerungen wurden
wochenlang in der "Spiegel"1)-Bestsellerliste geführt
und dienten, sehr frei bearbeitet, als Vorlage für den von Rainer Werner Fassbinder1)
mit Hanna Schygulla gedrehten Kinofilm
"Lili Marleen"1) (1981). |
Über die Künstlerin selbst wurden ebenfalls einige Biografien
publiziert:
1991 erschien im "Ullstein Verlag"1) das Werk "Lale Andersen, die Lili Marleen"
mit Auszügen aus bisher unveröffentlichten Tagebüchern,
verfasst von Tochter Litta Magnus-Andersen. Zum 30. Todestag der
Künstlerin kam 2002 von Gisela Lehrke die Biografie "Wie einst Lili
Marleen. Das Leben der Lale Andersen" auf den Markt.
Lale Andersens jüngster Sohn
Michael Wilke1) (1929 – 2017) veröffentlichte im Dezember 2009 das Buch
"Künstlerkind", in dem er von seiner Kindheit erzählt, gleichzeitig
aber auch einen Einblick in das Leben seiner berühmten Mutter gewährt. Auf
der Seite des Berliner Verlages "Deutsche Literaturgesellschaft" hieß es unter anderem: "Es wurde
viel geschrieben und berichtet über Lale Andersen und auch viele Jahrzehnte später
ist diese Geschichte aktueller denn je und wert, erzählt zu werden. Aber nicht
von jedem – am besten von dem, der dabei war: Michael Wilke, dem Künstlerkind".
Abbildung des Buchcovers
"Künstlerkind" mit freundlicher
Genehmigung der "Deutschen Literaturgesellschaft" |
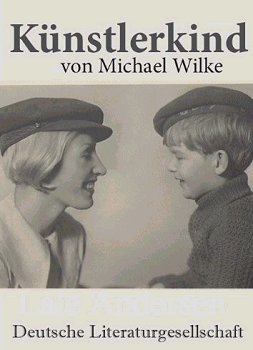 |
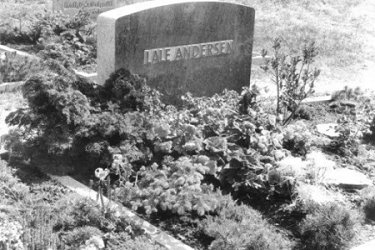
|
Die unvergessene Sängerin Lale Andersen starb am 29. August 1972
im Alter von 67 Jahren während einer Lesereise in einer Privatklinik in Wien1) an den Folgen ihrer
Leberkrebserkrankung und fand – gemäß ihrem Wunsch –
die letzte Ruhe auf dem "Dünenfriedhof"1) der Nordseeinsel
Langeoog1)
→ Foto der Grabstelle auch bei Wikimedia Commons
sowie knerger.de.
Artur Beul 1) starb am 9. Januar 2010, einen Monat nach seinem
94. Geburtstag, in Küsnacht1) bei
Zürich1). Seinem Wunsch
entsprechend wurde er am 14. Januar 2010 in
seinem Heimatort Lachen1)
(Kanton
Schwyz1))
beigesetzt.
Das Grab von Lale Andersen auf Langeoog
Das Foto darf mit freundlicher Genehmigung von Artur Beul
gezeigt werden;
die Rechte liegen bei Artur Beul (www.arturbeul.ch)
© Artur Beul
|
1999 wurde (bis 2012) auf Initiative der Leiterin des Kulturamtes Bremerhaven1),
Dr. Gisela Lehrke, der "Lale Andersen Preis"1) ins Leben
gerufen. Alle zwei Jahre wird dieser mit 5.000 Euro dotierte Preis an
Künstlerinnen und Künstler des Genres "Gehobene
Unterhaltungsmusik" vergeben. Die Initiative veranlasste die Tochter von
Lale Andersen, Carmen-Litta Magnus, der Stadt den Nachlass ihrer
Mutter zu schenken.
Auf Langeoog steht Andersens Wohnhaus, der "Sonnenhof". Ihr ältester Sohn, Björn Wilke, betrieb im
"Sonnenhof" einen Pensionsbetrieb, bis er das Anwesen verkaufte. Danach wurden im Vorderhaus
eine Teestube und ein Restaurant betrieben, das mit Erinnerungsstücken an Andersen dekoriert war. Heute
dient es als Ferienhaus.
→ Foto bei Wikimedia Commons (Quelle: Wikipedia)
In Bremerhaven
steht
seit 1981 eine ihr zugeeignete gusseiserne Laterne, an Lale Andersens Geburtshaus in
Bremerhaven-Lehe1)
(Lutherstraße 3) erinnert eine Gedenktafel
an die einst gefeierte Künstlerin. Am
23. März 2005 – ihrem 100. Geburtstag –
wurde auf
Langeoog Andersen zu Ehren eine von der Goldschmiedin und Malerin Eva Recker
geschaffene, lebensgroße Bronzestatue
enthüllt → eva-recker.de,
Wikimedia Commons
Für die ARD-Reihe "Legenden"1) entstand
von Britta Lübke1) die
45-minütige Dokumentation
"Lale Andersen"4) (EA: 13.08.2007), mit der das Leben und die Karriere der Sängerin beleuchtet
wird → spiegel.de.
|