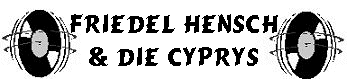Friedel Hensch wurde am 7. Juli 1906 in Landsberg
an der Warthe1) (heute: Gorzów Wielkopolski, Polen) geboren. Gemeinsam mit ihrem späteren
Ehemann Werner Cyprys1) (19.04.1922 – 30.07.2000),
den sie 1947 heiratete, und dessen Freund Karl Geithner (1922 – 1976) gründete sie im
Oktober 1945 in Hamburg die Gesangs-Formation
"Friedel Hensch und die Cyprys", welche sich in den 1950er
Jahren als Quartett mit dem weiteren Mitglied Heinz Bartels (Gesang) zu
einer der erfolgreichsten und beliebtesten Gesangsensembles entwickelte. Im
Januar 1946 trat die Gruppe erstmals im Hamburger Ballhaus "Trichter" auf der
Reeperbahn1) auf
(→ reeperbahn.com) und hatte mit ihrer musikalisch
swingenden Schau einen Riesenerfolg. Über Nacht wurden sie zu gefragten
Stars, vom Hamburger "Hansa-Theater"1),
dem "Tivoli"
im schwedischen Göteborg1)
bis hin zur zur Weltausstellung1) in
Brüssel1). Als Bartels
1947 die Gruppe verließ, um eine Stelle als Kapellmeister an den
"Städtischen Bühnen
Bremen"1)
anzutreten, stieß Kurt Krysock (1922 – ?) dazu, der 1957 nach
Kanada auswanderte. Ersetzt wurde er ab 1957 durch Hans-Joachim Kipka1) (1928 – 2008), der bis 1961
dem Ensemble angehörte; danach traten die die "Cyprys" nur noch als Trio auf.
Die "Cyprys" sangen sich bis Ende der 1950er Jahre in
die Herzen des Publikums, ob mit den humorigen Songs vom
"Tango-Max" oder "Ach Egon" (1952) bis hin zum gefühlvollen
"Holdrio, liebes Echo" (1950), "Über’s Jahr, wenn die Kornblumen blühen" (1951), "Oh Heideröslein"1) (1953),
"Der Wilddieb", "Die Försterlieserl" (1953), "Das alte Försterhaus"1) (1954),
die deutschsprachige Version von "Mambo
Italiano"1) (1955), "Oh Jägersmann" (1956) und
viele andere mehr. Was heute gerne als Schnulze abgetan wird, traf zur damaligen Zeit genau den
Geschmack des Publikums, dass sich von der traurigen Vergangenheit ablenken
lassen und nur noch in der Idylle schwelgen wollte. Wie auch
in den beliebten Heimatfilmen jener Ära, in denen es von Sennerinnen, Jägern und Wilderern
wimmelte, wurden diese auch in den Schlagern der "Cyprys" besungen.
Im Jahre 1953 erhielten die Gruppe ein Angebot, für zwei Jahre in die USA zu
gehen, sagte aber ab. Sie hatten so viel in Deutschland zu tun, dass sie nicht weg konnten,
aber auch befürchteten, bei aller Popularität nach zwei Jahren vielleicht vergessen zu sein.
Am 25. Februar 1961 nahm Friedel Hensch im "Kurhaustheater"1)
in Bad Homburg vor der Höhe1)
am deutschen Vorentscheid zum "Grand
Prix Eurovision de la Chanson"1)
(heute "Eurovision Song
Contest") teil, konnte bei der Veranstaltung "Die Schlagerparade"1) mit dem von ihrem Ehemann getexteten
und Ralf Arnie1) komponierten Titel
"Colombino" bei der Jury jedoch nicht punkten – Lale
Andersen ging als Siegerin vom Platz. 1962 verzeichneten "Friedel Hensch und die Cyprys" mit
dem Song "Mein Ideal", der Antwort auf das Chanson "Du läßt dich
geh'n" ("Tu t'laisses aller")
von Charles Aznavour, sowie
dem Schlager "Der
Mond von Wanne-Eickel" (Original: "Un clair de lune ŕ Maubeuge") ihre
letzten Hits. Im Folgejahr trat die Gruppe am 15. Juni 1963 im
"Kurhaus"1)
in Baden-Baden1)
mit dem Song "Ja, beim
Bossa-Nova-Ball" bei den "Deutschen
Schlagerfestspielen"1) auf, war
jedoch nicht erfolgreich und musste sich mit dem vorletzten von 12 Plätzen
zufrieden geben. "Nachdem 1965 ihr
letzter Vertrag bei der "Polydor"1) ausgelaufen war, veröffentlichten die drei
ihre letzten Schallplatten unter dem "Telefunken"1)-Label."
notiert Wikipedia.
Auf der Leinwand waren "Die Cyprys" in über 10 Kinoproduktionen zu
sehen und zu hören, Komponist Michael Jary1)
engagierte die Gruppe für den
Streifen "Mädchen mit
Beziehungen"1) (1950) und später für "Das singende Hotel"1). Außerdem sangen und spielten sie
unter anderem in den Streifen "Heimweh nach dir"1) (1952), der den Titel "Egon"
zum Welterfolg machte, in "Schlagerparade"1) (1953),
"Der
Himmel ist nie ausverkauft"1) (1955), "Symphonie
in Gold"1) (1956), "Wenn
Frauen schwindeln"1) (1957)
sowie in den ganz auf Heinz Erhardt zugeschnittenen Komödien "Natürlich
die Autofahrer"1) (1959) und "Ach
Egon!"1) (1961), wo sie in
letztgenannten Produktion einmal mehr den Hit "Egon" ("Eeeeegon, ich hab ja nur aus Liebe zu Dir, ja nur aus
lauter Liebe
zu Dir, ein Glas zuviel getrunken") zum
Besten gaben. Darüber hinaus präsentierte sich die Formation bzw.
Friedel Hensch in
etlichen TV-Sendungen → Übersicht Filmografie.
Im Oktober 1970 verabschiedete sich das Ensemble in der TV-Show
"Drei
mal neun"1) mit dem unvergessenen Wim Thoelke
von seinem Publikum. Zurückblicken
konnten "die Cyprys" auf eine ansehnliche Erfolgsbilanz wie 8 Millionen verkaufte
Platten und eine "Goldene Schallplatte"1) (1955), aber auch
auf unzählige Rundfunk- und TV-Sendungen. Erwähnenswert ist, dass die
Gruppe unter dem Namen "Tante Fröhlich und die Hutzelmännchen"
etwa 20 Kinderlieder für "Gnom", die Kinderserie der Plattenfirma
"Polydor", aufnahm.
Nach längerer Krankheit starb Friedel Hensch am 31. Dezember 1990
im Alter von 84 Jahren in Hamburg1);
ihr Ehemann Werner Cyprys, der 1992 eine zweite Ehe eingegangen war,
starb am 30. Juli 2000
im Alter von 78 Jahren, ebenfalls in der Hansestadt.
Die letzte Ruhe fand Friedel Hensch, wie später auch ihr Ehemann, auf
dem Hamburger "Neuen Niendorfer Friedhof"1).
Der Nachlass von "Friedel Hensch und die Cyprys" befindet sich im
Archiv des "Museums
für Hamburgische Geschichte"1).
Foto: Grabstelle von Friedel Hensch
Quelle: Wikimedia
Commons; Lizenz: CC BY-SA 3.0
Urheber: Udo Grimberg (Wikipedia-Benutzer
Chester100)
|

|
|
|
Im "Arcadia Verlag" (Hamburg) erschien 1954 das kleine Bändchen
"Friedel Hensch und die Cyprys" ("Arcadia
Starparade", Heft 1). Die Biografie, die auch einige Fotos beinhaltet, wurde von Dr. Ernst Schmacke
verfasst (ISBN: 3-923 925-46-8).
|

|
|
Quellen unter anderem: Wikipedia
(mit Diskografie),
fernsehmuseum-hamburg.de
|
|
Fremde Links: 1) Wikipedia
|
|
|
Filme (Auszug)
Filmografie bei der "Internet Movie Database": Friedel Hensch und die Cyprys
/ Friedel Hensch
/
(Fremde Links: Wikipedia, theatertexte.de, Die
Krimihomepage; R = Regie) |
Kinofilme
Fernsehen (Auszug)
- 1952: Eine
nette Bescherung (Premiere: 26.12.1952; Produktion: NWDR;
präsentiert von Peter
Frankenfeld;
R: Charlotte Mentzel; Gesang) → IMDb, peter-frankenfeld.de
- 1955: Frische Brise – Pfingstgrüße vom Ostseestrand (präsentiert von Peter
Frankenfeld; R: Ruprecht
Essberger; Gesang)
- 1959: Sind Sie frei, Fräulein? (2-teilige Musikshow; nach
einer Idee von Ernst Verch (auch Regie);
Mitwirkung/Gesang) → IMDb
- 1963: Eheinstitut Harmonie (Unterhaltungssendung; R: Dieter Pröttel; Friedel Hensch und Werner Cyprys als
Ehevermittler:
Kurzinfo: Ehevermittlerin Friedel Hensch und ihr Gemahl Werner Cyprys samt
"Sprechstundenhilfe" Evi Kent sind bemüht,
möglichst vielen Paaren Eheglück zu bereiten: Hannelore Auer und Willy
Schmid (1928–2013), Edith Schollwer und
Karl Geithner (1922–1976) sowie
Frieda Linzi (1932–1998) und Alain Nancey. Wird – bevor Ursula von Manescul ein
Tucholsky-Schlusswort
spricht – Michaela leer ausgehen?
Es spielt das SWF-Tanzorchester
unter der Leitung
von Rolf-Hans Müller. "Gong"
(09/1963): Turbulentes Potpourri im Gewand der Jahrhundertwende.
Bekannte Schlager- und Operettentexte
illustrieren ein juxiges Ehe-Anbahnungsinstitut.
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com)) → IMDb
- 1963: Stiftungsfest der
"Fleißigen Biene"
(eine musikalische Unterhaltungssendung mit "schweren" Jungen und
"süßen" Mädchen von Walter
Brandin; R: Arthur Maria
Rabenalt; Friedel Hensch als
Ehefrau
des 1. Vorsitzenden
eines Ganovenvereins (Kurt
Großkurth)
"Gong"
(17/1963): Turbulenter Musik-Klamauk im Milieu "ehrenwerter" Gangster a. D., die zum
Jubiläum
ihres Verbrecher-Vereins ein höchst vornehmes Fest arrangieren und dabei durch
einen noch tätigen
Hoteldieb (Günther
Fersch) aus dem Konzept gebracht werden.
"Hamburger Abendblatt"
(03.05.1963): Wer einigen Sinn für harmlosen Schabernack hat
und bereit ist, einmal nicht
alles ernst zu nehmen, wird sich hier gut unterhalten haben. Denn wer
hätte das gedacht: Diese als Kriminalgroteske
aufgezogene Show war tatsächlich mit leichter Hand
gemacht. Der alte Filmhase Arthur Maria Rabenalt hielt seine
Schäfchen nämlich allesamt so sicher
am Regie-Zügel, dass niemand "übertreten" konnte und die ganze leichte
Vergnügungsfahrt keinmal
aus den Geleisen geriet. (Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com)) → IMDb
- 1967: Lobby Doll und die Sitzstangenaffäre – Eine erdachte Rekonstruktion
(R/Drehbuch: Joachim
Roering;
mit Hans Putz
als Lobby Doll; Friedel Hensch als Sängerin
Kurzinfo: Lobby Doll erledigt als Interessensvertreter diffizile Beschaffungsaufträge für die
Luftstreitkräfte – unter
konstruktiver Mithilfe seiner Freundin Mirze Schwefel (Ellen
Schwiers) und nicht
immer zur Zufriedenheit des
Wehrministers und seiner Beamten. Als eines Tages 15.000 Vogelkäfige angeschafft werden,
die der mit allen Wassern
gewaschene Lobby dem Verteter der Luftwaffe, Dr. Arsing (Henning Schlüter), andrehen konnte,
geraten die umstrittenen
Beschaffungspraktikten des Wehrministeriums ins Visier eines geheimen parlamentarischen
Untersuchungsausschusses …
"Gong"
(25/1967) schrieb zur Erstausstrahlung: Satirisches Spiel. Parodie auf Missstände und Schwächen der
Demokratie.
auf bestimmte Praktiken der Gegenwart, auf ein Parlament ohne Opposition.
"Hörzu"
(28/1967) schrieb in ihrer Kritik: Mit Sommeranfang ging das große Fernsehspiel in Urlaub.
Die Unterhaltung
füllte die Lücken. "Lobby Doll" war allerdings kein Lückenbüßer, sondern eine
pfiffige Satire mit Tiefgang. (…)
Joachim Roering hatte in Buch und Regie
Dutzende kleiner Giftspritzen verpackt, so dass es in Bonn wohl niemand gab,
der sich nicht wiedererkannte. Aber selbst Herbert
Wehner, dem Kurt Pratsch Kaufmann einen glänzenden Spiegel
vorhielt, dürfte in das Schmunzeln der Fernseher mit eingestimmt haben.
(Quelle: tvprogramme.shoutwiki.com)) →
IMDb
|
|