|
Wie einige andere renommierte Theaterkollegen, etwa Fritz Delius,
Theodor Becker
oder Maria Fein,
die sich für kurze Zeit dem noch jungen Medium
Film zuwandten, machte auch Bruno Decarli ab 1916 Erfahrungen vor der Kamera
und hinterließ bis Anfang der 1920er Jahre mit seinen wenigen Produktionen
nachhaltige Spuren auf der noch stummen Leinwand.
|
|
|
|
Zu seinen ersten Leinwandauftritten, mit denen er wie auf der
Bühne nachhaltigen Eindruck hinterließ, zählten unter der
Regie Rudolf Biebrachs der Joachim von Trautendorff in dem Melodram "Gelöste Ketten"1) (1916)
und der Graf von Fahrenwald in dem von Robert Wiene nach einer Kriminal-Erzählung von
Ernst von Wildenbruch1) in Szene
gesetzte Drama "Das wandernde Licht"1) (1916) – jeweils
mit dem damaligen "Topstar" Henny Porten als Partnerin, mit
der noch einige weitere Produktionen folgen sollten.
|
Felix Basch besetzte
Decarli neben Mia May
als Geigenvirtuosen Carlos Valdez in der rührseligen Geschichte "Die
Silhouette des Teufels"1) (1917), Mia May-Gatte
Joe May1) an der Seite
seiner Ehefrau in "Die Liebe der Hetty Raymond1) (1917)
als Hans van Gent.
Als Robert Wiene den Horror-Streifen "Furcht"1) (1917) drehte,
war Decarli für ihn die ideale Besetzung für den von Visionen
verfolgten und fast wahnsinnig vor Furcht werdenden Graf Greven, Conrad Veidt
mimte einen indischen Priester, Bernhard Goetzke Grevens Diener und
Mechthild Thein
die Geliebte des Grafen. Als "vertiefte Psychologenarbeit"
wurde der Film von der Kritik aus dem übrigen Angebot – teils lobend, teils warnend – hervorgehoben:
"Ein Drama (…), welches im Rahmen einer psychologischen Studie durch seine
Romantik und Mystik, aber auch durch das absonderliche Gemisch von Schönem und Grauenhaften die Zuschauer tief in seinen Bann zieht."
("Der Film" 39, 29.9.1917; vgl. LBB 38, 22.9. 1917 und "Kinematograph"1) 561, 26.09.1917).3)
Der Streifen "Furcht" gehörte wie die psychologische "Charakterstudie
"Der Richter"1) (1917)
nach dem gleichnamigem Roman von Hans Land1) zu einer eher kurzlebigen "Decarli-Serie" der von Oskar
Messter1) gegründeten "Messter-Film", doch "bereits vor der Jahreswende 1917/18 stellte die
"Messter-Film" ihre "Bruno-Decarli-Serie" wegen
fehlender Popularität wieder ein.3)
Foto: Bruno Decarli vor 1929
Urheber: Alexander Binder1)
(1888 – 1929)
Quelle: cyranos.ch;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
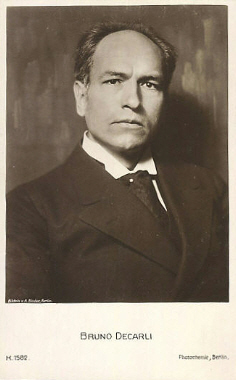
|
Das Jahr 1919 war ebenfalls äußerst produktiv für Decarlis filmische
Arbeit, rund 15 Streifen mit ihm in Haupt- und Nebenrollen gelangten in die
Lichtspielhäuser. Darunter auch Joe Mays achtteiliger Sensations- und
Abenteuerfilm "Die
Herrin der Welt"1) (1919), in dem er in den
Teilen 1, 4 und 8 zur Besetzung gehörte.
Für Conrad Tietzes "Macht-Film" übernahm er 1919 die
männliche Hauptrolle in dem mit Jugendverbot belegten Streifen "Das Gift im
Weibe", bei dem er gemeinsam mit Carl Neisser1) auch Regie führte.
Mit "Uriel Acosta" (1920), einer Adaption der Novelle
"Die Sadduzäer von Amsterdam" (1834) bzw. der
Tragödie "Uriel Acosta" (1846) von Karl Gutzkow1), mit dem die Kämpfe um die jüdischen Glaubensfreiheit in Spanien und
Holland thematisiert wurden, starteten einige Filme seiner eigenen
"Decarli-Film KG"; in "Uriel Acosta"
trat Decarli unter der Regie von Ernst Wendt1) zudem als der historische
Religionskritiker und Freidenkers Uriel da Costa1) (1585 – 1640) auf.
Weitere Produktionen mit Decarli bzw. der "Decarli-Film"
waren unter anderem Reinhard Brucks1)
Drama "Brigantenrache"1) (1920)
nach einer Novelle von Konrad Telmann1) an der Seite von
Asta Nielsen und der ebenfalls von "Horror-Spezialist" Ernst Wendt in Szene gesetzte Streifen "Der Unheimliche" (1922).
Foto: Bruno Decarli vor 1929
Urheber: Alexander Binder1)
(1888 – 1929)
Quelle: Wikipedia;
Photochemie-Karte Nr. 1584;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
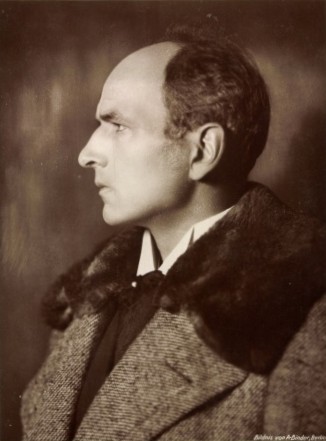
|
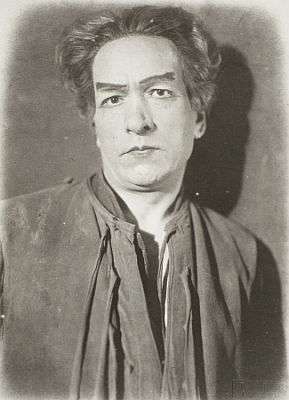 |
Bereits seit Anfang der 1920er Jahre hatte sich Decarli wieder verstärkt
auf seine Theaterkarriere konzentriert, zur Spielzeit 1923/24 wechselte er
an das "Staatstheater Dresden"1), dem er bis zur Schließung aller
deutscher Spielstätten im Sommer 1944 verbunden blieb und viele
große Charakterrollen gestaltete. So erlebte man ihn
gleich zu Beginn als Lord Sir Henry Percy1) im ersten Teil von Shakespeares Drama
"König Heinrich IV."1), eine Figur, die er auch in der
Neuinszenierung 1926 gab, im gleichen Jahr war er als grandioser "König Lear"1) zu bewundern.
Als Shakespeare-Interpret erlebte man den Künstler unter
anderem als Prosperos wilden und missgestalteten Sklaven Caliban in dem
Schauspiel "Der Sturm"1) und als reichen Edelmann Baptista in der
Komödie "Der Widerspenstigen Zähmung"1). In
Hugo von Hofmannsthals1)
"Jedermann"1) machte er 1925 auch bei einem Gastspiel in
Meißen1) mit
der Titelrolle Furore, er verkörperte weiterhin beispielsweise den Herzog Skule
in dem historischem Stück "Die Kronprätendenten"1)
von Henrik Ibsen1) und den
Geheimrat Matthias Clausen in dem Drama "Vor Sonnenuntergang"1)
(1932) von Gerhart Hauptmann1)
mit Lotte Meyer1) als Inken Peters
→ einige Rollenportraits siehe hier.
Bruno Decarli als Sir Henry Percy in "König Heinrich IV." (1.Teil)
von William Shakespeare ("Staatstheater Dresden"1), ab Spielzeit 1923/1924),
fotografiert von Ursula Richter1) (1886–1946)
Quelle: Deutsche
Fotothek, (file: df_pos-1986-c_0000007_001)
Eigentümer / © SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Ursula
Richter/Datierung: 1926
Quelle: www.deutschefotothek.de;
Genehmigung zur Veröffentlichung: 30.03.2017
|
|
Nach Kriegsende übernahm der zuletzt vollkommen weißhaarig gewordene
"Königliche Hofschauspieler" Bruno Decarli keine
Theaterverpflichtungen mehr und verbrachte seine letzten Lebensjahre bei
seiner ältesten Tochter in Großbritannien, wohin er 1946 gezogen war. Dort
starb der einst gefeierte Charaktermime am 31. März 1950
in Frogwell4) (Grafschaft
Cornwall1)) – zwei
Wochen nach seinem 73. Geburtstag.
|
|

|
Quelle (unter anderem): Wikipedia,
cyranos.ch;
Fotos bei virtual-history.com,
filmstarpostcards.blogspot.com
|
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) Murnau Stiftung
Quelle:
3) www.filmblatt.de:
FILMBLATT 8 (Herbst 1998): Hrsg.: CineGraph Babelsberg e.V. (Berlin-Brandenburgisches Centrum für Filmforschung)
4) gemäß Volker Wachter lt. Information des Staatstheaters Dresden (Archiv):
laut Wikipedia gestorben in in Tiverton
(Devon),
Lizenz Foto Bruno Decarli (Urheber: Alexander
Binder/Wilhelm Willinger): Diese Bild- oder Mediendatei ist
gemeinfrei, weil
ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die
Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren
Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod
des Urhebers.
*) Mac Walten, das ist der Verwandlungskünstler
Max Grünthal, der als "Mac Walten" bzw. der "Mann
mit dem geheimnisvollen Rock" auftrat. Er verabschiedete sich 1920
von der Bühne, eröffnete in der Berliner Friedrichstraße ein Fotostudio
und lichtete viele Artistenkollegen in Originalposen ab. Seine Spur verliert
sich im Jahre 1936, nachdem er als Jude vor den Nazis in die
Niederlande geflohen war. (Quelle: www.scheinschlag.de)
Lizenz Foto Bruno Decarli (Urheber Mac Walten):
Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von
dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen
und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.
|

|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database
sowie filmportal.de
sowie
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"
(Fremde Links: Wikipedia, filmportal.de, Murnau Stiftung; R
= Regie) |
Stummfilme
- 1916–1918: Filme von (Regie) Rudolf
Biebrach (meist auch Darsteller); mit Henny Porten in der weiblichen Hauptrolle
- 1916: Das wandernde Licht
(nach der Novelle von Ernst von Wildenbruch;
R: Robert
Wiene; mit Henny Porten;
als Graf von Fahrenwald) → filmportal.de,
Murnau Stiftung
- 1916/17: Die Nixenkönigin
(R: Louis Neher;
als ?)
- 1917: Der Mann im Spiegel
(R: Robert
Wiene; als "der Rächer")
- 1917: Die
Silhouette des Teufels
(R: Felix
Basch, Joe May;
mit Mia
May; als der Geigenvirtuose Carlos Valdez)
→ filmportal.de (Foto),
Murnau Stiftung
- 1917: Die Liebe der Hetty Raymond
(R: Joe May, mit dessen Ehefra Mia May als Hetty Raymond; als
Hans van Gent)
→ Murnau Stiftung
- 1917: Das Gewissen des Andern (R: Emmerich
Hanus; als ?) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Der Richter
(nach dem Roman von Hans
Land (auch Drehbuch); R: ?; als Gerichtsassessor van Liers,
Verlobter von Lisa Redern (Lina
Salten); Otto
Gebühr als deren Verführer Eduard Dekker) → Murnau Stiftung
- 1917: Vertauschte Seelen (R: Hans
Oberländer; als der Graf / der Maler) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1917: Furcht
(R: Robert
Wiene; als Graf Greven) → filmportal.de
- 1918: Im Zeichen der
Schuld: Aus dem Leben eines Vorbestraften (R: Richard
Eichberg; als Arndt Vandram,
Inhaber des ostindischen Bankhauses "Bandram & Barker")
- 1918: Der Rubin-Salamander
(nach dem Roman "Die Brüder" von Paul Lindau;
von (Regie) und mit Rudolf
Biebrach;
als Martin Hellberg, Bruder des angesehenen Juristen
Landgerichtsrat Gottfried Hellberg (Biebrach))
→ Murnau Stiftung
- 1919: Die Nackten.
Ein sozialpolitischer Film (R/Drehbuch: Martin
Berger; als ?) → Early Cinema Database
- 1919: Rebellenliebe
(R: Heinz
Carl Heiland; als Graf Wolfburg) → Early Cinema Database
- 1919: Morphium
(R: Bruno Ziener;
als der Kapellmeister) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Jettatore
(R: Richard
Eichberg; als Baron Gaston de Saint Amant) → Early Cinema Database
- 1919: Fräulein Mutter
(R: Carl
Neisser; als ?) → Early Cinema Database
- 1919: Die siebente Großmacht
(R: Willy
Grunwald; als ?) → IMDb
- 1919: Die
Herrin der Welt (acht Teile; R: Joe
May (Teil 2, 3, 8)/Josef
Klein (1, 4)/Uwe
Jens Krafft (Teil 4–6)/
Karl
Gerhardt (Teil 7); mit Mia
May in der Titelrolle; als ?)
- 1919: Der Tempelräuber (R: Heinz
Carl Heiland; als der Inder Ellipam) → Early Cinema Database
- 1919: Das Lächeln der kleinen Beate
(R: Georg
Schubert; mit Hilde
Wörner in der Titelrolle; als ?)
→ IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Sünden der Eltern
(R: Richard
Eichberg; als Portierssohn Karlemann) →
IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Der Hirt von Maria Schnee
(R: Iwa
Raffay; als der Hirt; auch Produktion)
- 1919: Das Gift im Weibe (als
Sohn des Fabrikanten; auch Co-Regie mit Carl
Neisser)
→ Early Cinema Database
- 1920: Uriel Acosta (nach
der Novelle
"Die Sadduzäer von Amsterdam" (1834) bzw. der
Tragödie
"Uriel Acosta" (1846) von Karl Gutzkow;
R:
Ernst
Wendt; als Uriel
Acosta; auch Produktion) → Early Cinema Database
- 1920: Störtebecker (R: Ernst Wendt; als Klaus Störtebeker;
auch Produktion) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1922: Brigantenrache
(nach einer Novelle von Konrad
Telmann; R: Reinhard
Bruck; mit Asta
Nielsen als Anica,
Ehefrau von Danilo (Walther
Brügmann); als Ruggiero, den Anica eigentlich liebt; auch Produktion) → filmportal.de
- 1922: Der Unheimliche
(R:
Ernst
Wendt; als Eduard, Sohn des Wiener Bankiers Josias von Totleben
(Heinrich
Marlow)
bzw. heimlicher Ehemann von Angelica (Margot von Hardt); auch Produktion) → IMDb
- 1922: Ein neues Leben / De bruut (R:
Theo
Frenkel; als Henri Norwart) → IMDb
- 1922: Die Liebeslaube
(R: Wolfgang
Neff; als ?)
- 1922: Fridericus Rex
(Fridericus-Rex-Film;
4 Teile; R: Arzen
von Cserépy; mit Otto
Gebühr als Preußenkönig Friedrich II.;
als Minister Friedrich
Wilhelm von Grumbkow)
- 1923: Ein Glas Wasser
(nach dem Lustspiel "Das
Glas Wasser" von Eugène
Scribe; R: Ludwig
Berger;
mit Mady
Christians als Königin Anna: als Marquis von Torcy) → filmportal.de,
Murnau Stiftung
- 1923: Der Mann mit der eisernen Maske
(nach dem Roman von Alexandre
Dumas d.Ä.; R: Max
Glass;
mit Wladimir
Gaidarow als Ludwig
XIV. sowie dessen Bruder Bertrand, der "Mann mit der
eisernen Maske";
als Hugenottenführer Gaston d’Aubigny)
- 1923: Scheine des Todes
(R: Lothar Mendes;
als Henry, erblüsterner Bruder von Lord Hull (Alfred
Abel))
Tonfilme
|
|

|
|
|

