|
Begibt man sich auf die Spurensuche nach der Schauspielerin Grete Diercks, stellt man fest, dass
im Laufe der Jahrzehnte offensichtlich die
Biografien bzw. Daten zweier Künstlerinnen miteinander verwoben wurden:
Einerseits gab es die am 20. November 1882 in Stainach-Irdning (Steiermark)
geborene österreichische Operettensoubrette und Schauspielerin Margarete "Grete" Dierkes1) (gestorben am 2. Juli 1957 in Wien),
zum anderen die in Deutschland geborene Theater- und Stummfilmdarstellerin Margarethe Diercks,
die unter dem Künstlernamen Grete Diercks (mitunter auch "Dircks")
in Erscheinung trat. Letztere, Tochter eines selbstständigen
Steinsetzers, erblickte am 1. September 1890 in Hamburg
das Licht der Welt, wuchs mit ihren vier Schwestern Klara, Emma, Irma und Herta
auf.
|
 |
Aufgrund der Informationen, die von Grete Diercks' Nachfahren stammen,
machte sie bereits als kleines Mädchen erste Schritte auf der Bühne und avancierte am
Hamburger "Deutschen
Schauspielhaus"1) zu einem beliebten Kinderstar: Am 15. September 1900 hatte die feierliche Eröffnung des "Deutschen
Schauspielhauses" stattgefunden und man suchte damals jugendliche
Darsteller. Margarethe bewarb sich ohne Wissen der Eltern zusammen mit einer
Freundin, trug das Lied "Letzte Rose" aus der Oper
"Martha"1)
von Friedrich von Flotow1) vor und wurde engagiert. Belegt ist, dass sie erstmals
zur Spielzeit 1901/02 mit der Titelrolle in "Wie Klein-Else das Christkind suchen
ging", einem Weihnachtsmärchen mit Gesang und Tanz von Therese Lehmann-Haupt
(1864 – 1914), betraut wurde. Bis 1908/09 stand sie mit
Kinder-/Jungmädchenrollen in Hamburg auf der Bühne, feierte unter anderem
zur Spielzeit 1907/08 mit der Titelrolle
in der Operette "Prinzessin Herzlieb" des Komponisten bzw.
Dirigenten Eduard Möricke1) Erfolge,
wie ein Foto beweist
→ www.flickr.com;
mehr zu den Rollen am "Deutschen Schauspielhaus" siehe hier.
Grete Diercks startete
eine intensive, wenn auch kurze Karriere am Theater, später kam der Film
hinzu. Ohne je eine schauspielerische Ausbildung erhalten zu haben, blieb
die junge Frau den "Brettern, die die Welt bedeuten" treu,
sammelte – auch als Sängerin – weitere Bühnenerfahrungen unter anderem 1912 einen Sommer lang am
Theater in Riga1), wo sie auch erstmals ihren späteren Ehemann, den Ingenieur
Curt von Grueber traf.
Foto: Grete Diercks ca. 1907/1908
Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,
zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati
Urheber: Unbekannt; Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier
|
|
Nicht eindeutig geklärt zu sein scheint, ob Grete Diercks mit
dem damals siebenjährigen Curt Bois zusammen
aufgetreten ist.
Am 23 Oktober 1908 fand im Berliner "Theater des Westens"1) die
Premiere der Operette "Der fidele Bauer"1)
von Leo Fall1) mit Bois als
kleinem Heinerle statt, nur fünf Tage später konnte das
"Heinerle"-Duett mit seiner Partnerin (der Magd "die rote
Lisi") auf Schallplatte käuflich
erworben werden, gleichzeitig kam von der "Deutschen Bioscop"
unter anderem die berühmte Szene bzw. das Lied "Heinerle, Heinerle,
hab' kei Geld" (Duettino zwischen Liesl und Heinerle"2))
und das "1. Terzett: Ein Infant'rist, ein Artill'rist"
(zusammen Gustav Matzner3)) als
so genanntes
"Tonbild"1) in die Lichtspielhäuser, eine Verbindung zwischen
stummen bewegten Bildern und der Grammophon-Aufnahme. In etlichen Quellen
(u.a. filmportal.de, IMDb sowie sonstigen einschlägigen Filmseiten) wird
Grete Diercks bei diesen beiden "Tonbildern" aufgeführt,
es gibt jedoch eine alte Postkarte (→ ansichtskartenhandel.at),
auf der eindeutig Grete Dierkes gezeigt bzw. genannt wird. Wikipedia merkt
zudem an, dass die angebliche Mitwirkung von Grete Diercks an der Seite von Curt Bois in
(dem Tonbild) "Der fidele Bauer" (1908) fraglich sei, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht in Berlin weilte.
Foto: Grete Diercks 1912 in Berlin
Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete
Diercks,
zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati
Urheber: Unbekannt; Originalfoto aufrufbar bei Wikimedia
Commons;
Lizenz: CC BY-SA 3.0
|
 |
|
Nach ihrem kurzen Engagement in Riga zog es die junge Künstlerin noch
im Herbst 1912 in die Metropole
Berlin, wo sie weiterhin am Theater aktiv war, aber auch Kontakte zur
Stummfilmszene knüpfen konnte. Ab Mitte der 1910er Jahre stand
Grete Diercks regelmäßig vor der Kamera und wirkte bis 1923 in
etlichen Produktionen mit, darunter befanden sich auch zwei von Ernst Lubitsch1) inszenierte Stummfilm-Klassiker: |
 |
In der Adaption "Carmen"1) (1918)
nach der gleichnamigen
Oper1) von Georges Bizet1) bzw.
der gleichnamigen
Novelle1) von Prosper Mérimée1), wo
sie nach einigen Quellen auch am Drehbuch beteiligt
gewesen sein soll,
mimte sie an der Seite von
Pola Negri in der Titelrolle als Dolores die Braut des Dragoners Don José
(Harry Liedtke), in der
Strindberg1)-Verfilmung "Rausch"1) (1919)
neben Asta Nielsen als Protagonistin Henriette die Jeanne, welche von
ihrem Ehemann, dem Schriftstellers Gaston (Alfred Abel), im Rausch der
Gefühle für Henriette verlasen wird. Sie trat beispielsweise in der von
(Regie) und mit Viggo Larsen realisierten Komödie "Der
Einbrecher wider Willen"1) (1918)
in Erscheinung oder in
dem Melodram "Die Frauen vom Gnadenstein"2) (1921; Regie:
Robert Dinesen1)).
Als E. A. Dupont1) erstmals das
Alpen-Drama "Die
Geierwally"1) (1921) nach
dem gleichnamigen
Roman1) von
Wilhelmine von Hillern1) mit Henny Porten auf die Leinwand bannte, besetzte er
Grete Diercks als Magd Afra, die mit Bären-Joseph (Wilhelm Dieterle)
angeblich eine
Liebschaft hat bzw. dessen Halbschwester ist.
Foto: Grete Diercks 1912 in Riga
Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete
Diercks, zur Verfügung gestellt
von deren Enkel Peter Schati;
Urheber: Unbekannt; Originalfoto aufrufbar bei
Wikimedia
Commons; Lizenz: CC BY-SA 3.0
|
|
Auch in Friedrich Wilhelm Murnaus1) Meisterwerk "Der
brennende Acker"1) (1922) präsentierte sich Grete Diercks als duldsames Bauernmädchen Maria bzw.
verlassene Braut des Johannes Rog (Wladimir Gaidarow) mit einer tragenden Rolle,
ebenso wie in dem Melodram "Der Liebe Pilgerfahrt"1) (1923; Regie:
Jacques Protosanoff1))
mit Gustav von Wangenheim als Partner. Nach den Streifen
"Die
Kette klirrt"1) (1923; Regie: Paul L. Stein1), "Und dennoch kam das Glück" (1923;
Regie/Drehbuch: Gerhard Lamprecht1)) sowie "Die Sonne von St. Moritz"1) (1923; Regie:
Hubert Moest1)/Friedrich Weissenberg),
gedreht mit Moests Ex-Ehefrau Hedda Vernon
in der weiblichen Hauptrolle nach dem gleichnamigen Unterhaltungsroman von Paul Oskar Höcker1), beendete die
Schauspielerin ihre kurze, intensive Filmkarriere → Übersicht
Stummfilme.
|
Als Theaterschauspielerin verabschiedete sie sich ebenfalls von ihrem Publikum, parallel zu ihrer
Arbeit vor der Kamera hatte sie an verschiedenen Berliner Bühnen Erfolge
gefeiert. So beispielsweise 1917 am "Theater in der Königgrätzer
Straße" (heute "Hebbel-Theater"1)) oder
am "Komödienhaus"1),
wo sie 1918 in dem Schauspiel "Die Zarin", einer freien Version
über den Werdegangs der russischen Zarin Katharina II.1) von Menyhért Lengyels1) und
Lajos Birós1),
aufgetreten war.4))
Grete Diercks verschwand aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit,
Grund hierfür war 1923 ihre Eheschließung mit dem Ingenieur bzw.
Fabrikanten Curt von Grueber (1874 – 1962), der 1906 in Berlin das Unternehmen
bzw. Konstruktionsbüro "Maschinenfabrik für Hartzerkleinerungs- und Transportanlagen Curt von Grueber" gegründet hatte und Mahlanlagen für Gestein, Kohle und
Metall herstellte. Aus der Verbindung mit Curt von Grueber, bereits
Vater von drei Kindern aus seiner ersten Ehe, die nach der Scheidung bei der
Mutter blieben, hatte Grete Diercks zwei Töchter: Ursula wurde am
15. Oktober 1923, Lieselotte am 18. Juni 1926 geboren.
Foto: Grete Diercks kurz nach der Eheschließung im Jahre 1923
Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,
zur Verfügung
gestellt von deren Enkel Peter Schati
|
 |
|
Anfangs lebte die Familie in Berlin-Lichterfelde1) in einem angemieteten Haus in
der Augustastraße, später erwarb von Grueber eine eigene
Villa in Berlin-Dahlem1),
welche während des Krieges nach einem Bombenangriff Ende
August 1943 komplett zerstört wurde; die Familie verlor wie so
viele andere ihr gesamtes Hab und Gut.1937 war die damalige "Curt von Grueber Maschinenbauanstalt" in den Alleinbesitz
des Unternehmers und Erfinders Ernst Curt Loesche († 1948) übergegangen, der 1919 Teilhaber der Firma geworden
war → www.loesche.com.
Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde das Werk zunächst
durch die sowjetische Besatzungsmacht vollständig
demontiert, 1948 dann entschädigungslos enteignet und in den volkseigenen
Betrieb "LBH-Teltow" umgewandelt →
brandenburgikon.net.
 |
Grete Diercks erlebte das Kriegsende auf einem Bauernhof in Tirol
(Österreich), wohin Tochter Lieselotte von München aus geflohen war und
ihre Mutter wenige Monate später aus Berlin nachholte. Als nach der Befreiung Österreichs Ende März 1945
durch die sowjetischen Truppen alle Deutschen das Land verlassen mussten,
strandeten Mutter und Tochter schließlich im schwäbischen Lauingen1)
(Bayern). Hier wohnte Grete Diercks lange Jahre in einem abseits gelegenen Mühlenhäuschen direkt an der
Donau, führte ein relativ einsames Leben bis ins hohe Alter hinein. Die Ehe
mit Curt von Grueber existierte bis zu dessen Tod wohl nur noch auf dem
Papier, nach Kriegsende lebte das Paar mehr oder weniger getrennt.
Ihre letzten Jahre verbrachte Grete Diercks in einem kirchlichen Altersheim
in Lauingen, wo sie – rund sechs Wochen vor ihrem 78. Geburtstag – am 15. Juli 1978
starb. Wie so viele Künstler(innen) jener Ära ist auch sie vollkommen in
Vergessenheit geraten.
Grete Diercks auf einer Autogrammkarte (Photochemie-Karte, Nr.2712)
Quelle: Privates Fotoarchiv der Nachfahren von Grete Diercks,
zur Verfügung gestellt von deren Enkel Peter Schati
Urheber: Photoatelier Mac Walten (1892 – 1943); Lizenz:
gemeinfrei
→ Info zu Mac Walten
|
|

|
Quelle (unter anderem): Informationen des Enkels (Peter Schati) von Grete
Diercks,
der auch das Fotomaterial zur Verfügung stellte.
Siehe auch Wikipedia,
cyranos.ch
|
Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) Murnau Stiftung, 3) cyranos.ch
4) Quelle: Siegfried Jacobsohn:
Gesammelte Schriften 1900–1926 (Wallstein Verlag, 2005, S. 463)
Lizenz Foto Grete Diercks: Dieses Medium (Bild,
Gegenstand, Tondokument, …) ist gemeinfrei,
da das Urheberrecht abgelaufen ist und die Autoren unbekannt sind. Das gilt in
der EU und solchen Ländern, in denen das Urheberrecht 70 Jahre nach
anonymer Veröffentlichung erlischt.
Marc Walten: Das ist der Verwandlungskünstler
Max Grünthal, der als "Mac Walten" bzw. der "Mann
mit dem geheimnisvollen Rock" auftrat. Er verabschiedete sich 1920
von der Bühne, eröffnete in der Berliner Friedrichstraße ein Fotostudio und
lichtete viele Artistenkollegen in Originalposen ab. Seine Spur verliert sich
im Jahre 1936, nachdem er als Jude vor den Nazis in die Niederlande
geflohen war. (Quelle: www.scheinschlag.de)
|

|
Mitwirkung (weitgehend gesichert) in folgenden
Stummfilmen
Filmografie bei der Internet Movie Database1),
filmportal.de
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"1)
(Fremde Links: filmportal.de, Wikipedia, Murnau Stiftung; R = Regie) |
- 1916: Die Fiebersonate
(R: Emmerich Hanus;
als Hedwig, Nichte von Frau Werner (Frida
Richard),
der Mutter von Rolf (Friedrich
Zelnik)) → Early Cinema Database
- 1917: Unsühnbar
(R: Georg
Jacoby; als ?) → www.dhm.de
- 1918: Carmen
(nach der gleichnamigen
Oper von Georges
Bizet bzw. der gleichnamigen
Novelle von Prosper
Mérimée;
R: Ernst
Lubitsch; mit Pola
Negri als Carmen, Harry
Liedtke als Dragoner Don José Navarro; als Dolores,
Braut von Don José; (laut IMDb auch Drehbuch mit Norbert
Falk und Hanns Kräly)
→ Murnau Stiftung, filmportal.de
- 1918: Fünf Minuten zu spät
(R: Uwe Jens Krafft;
als ?)
- 1918: Durchlaucht Hypochonder
(R: Friedrich
Zelnik: mit Lisa
Weise als Prinzessin Lisa, genannt "Durchlaucht Hypochonder";
als Fürstin Lolo, Nichte von Lisa)
- 1918: Keimendes Leben
(2 Teile; R: Georg
Jacoby; als Arbeiterin Liese Bräuer, Geliebte von Fabrikant
Friedrich Wechmar (Hans
Junkermann))
- 1918: Der
Einbrecher wider Willen (von (Regie) und mit Viggo
Larsen; als Margit Hesse) → Murnau Stiftung
- 1919: Rausch (nach dem Bühnenstück "Rausch" ("Brott och
Brott") von August
Strindberg; R: Ernst
Lubitsch;
mit Asta
Nielsen als Henriette, Ehefrau des Malers Adolph (Carl
Meinhard); Alfred
Abel als dessen Freund,
der Schriftsteller Gaston; als dessen verlassene Ehefrau Jeanne) → filmportal.de
- 1919: Todesurteil
(R: Martin
Berger; als ?) →
IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Zwangsliebe im Freistaat (R: Georg
Schubert; als Dienstmädchen Maria, Braut von Hans Wellert (Helmut
Krauss))
→ Early Cinema Database
- 1919: Filme mit Mac Walten (von
(Regie) und mit Leonhard Haskel;
als ?)
- 1921: Die Frauen vom Gnadenstein
(R: Robert Dinesen;
als als Rose-Marie)
- 1921: Die
Geierwally (nach dem gleichnamigen
Roman von Wilhelmine
von Hillern; R: E.
A. Dupont mit Henny Porten
als Geier-Wally, Wilhelm Dieterle
als "Bären-Joseph"; als Magd Afra)
→ filmportal.de
mit Kritik aus
- 1922: Der
brennende Acker (R: Friedrich
Wilhelm Murnau; als das Bauernmädchen Maria) → filmportal.de
- 1922: Das Feuerschiff
(R: Richard
Löwenbein; als ?)
- 1922: Am Rande der Großstadt
(nach dem Roman "Die Mausefalle" von Erna Weißenborn;
R: Hanns Kobe; als ?)
- 1922: Der Kampf ums Ich
(R: Heinrich
Brandt; als ?)
- 1923: Der Liebe Pilgerfahrt
(R: Jakow
Protasonow; als Karin, Gustav
von Wangenheim als Dr. Egil Rostrup)
→ Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1923: Die Kette klirrt
(R: Paul
L. Stein; (vermutlich) als Senta)
- 1923: Und dennoch kam das Glück
(R: Gerhard Lamprecht; als ?)
- 1923: Die Sonne von St. Moritz
(nach dem Roman von Paul Oskar Höcker;
R: Hubert
Moest, Friedrich Weissenberg;
mit Moests Ex-Gattin Hedda
Vernon in der weiblichen Hauptrolle der "Dame von Welt"
Hedda; als die Amerikanerin
(Zuordnung unsicher), große Liebe des
Dr. Heinemann (Johannes
Riemann))
|
|
|
1) Anmerkung: Das dort
aufgeführte Tonbild "Der Fidele Bauer" (1908) sowie das in
Österreich gedrehte Gesellschafts-Melodram "Die Musikantenlene" (1912)
ist wohl Grete Dierkes zuzuschreiben, die in letzterem kurzem
Streifen als Chanson-Sängerin Joujou neben Titelheldin Eugenie Bernay
in Erscheinung trat (Link: Wikipedia).
|

|
Hier noch einige Fotos aus dem
Archiv der Familie Diercks,
zur Verfügung gestellt von Grete Diercks-Enkel Peter Schati
(Fotograf: unbekannt) |
 |
| Grete Diercks 1912 in Riga |
|
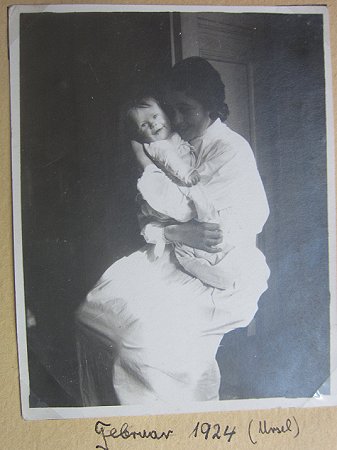 |
| Grete Diercks mit Tochter Ursula |
|
 |
| Grete Diercks im Frühjahr 1923
mit Ehemann Curt von Grueber |
|
|

