Herausragende Interpretationen waren unter der Regie von Hans Oberländer
die Frau Brigitte in dem Kleist-Lustspiel "Der
zerbrochne Krug"1) (1905) oder die
Rolle der Eurydike1)
in der Tragödie "Antigone"1) (1906) des Sophokles1). Sie
glänzte als Julia in der Shakespeare-Tragödie"Romeo und Julia"1),
als Königin Anna in
dem Lustspiel "Das Glas Wasser"1) von Eugčne Scribe1) oder
als die
Königin von Holland Hortense1) in dem Schauspiel "Napoleon oder Die
hundert Tage"1) von Christian Dietrich Grabbe1).
Hatte sie in ihrer Anfangszeit
das Fach der jugendlichen Heldin ausgefüllt, machte sich Ilka Grüning
im fortgeschrittenen Alter mit Charakterrollen vor allem in Stücken von
Henrik Ibsen1) und Gerhart Hauptmann1) einen Namen. Am "Lessingtheater" brillierte
sie unter anderem als Mutter Aase in Ibsens "Peer Gynt"1) (1913/1914)
mit Friedrich Kayßler in der Titelrolle
(auch 1916/1920 sowie 1917 am "Theater
an der Wien" mit Theodor Loos als Peer Gynt,
Lina Lossen1) als Solveig)
oder als Aline Solness in Ibsens "Baumeister
Solness"1) (1915–1918) mit Albert Bassermann als Bauunternehmer Halvard Solness, jeweils in Inszenierungen des Intendanten Victor Barnowsky1). Dieser
besetzte Grüning in weiteren Ibsen-Werken neben Bassermann, so als Gina Ekdal in dem
Schauspiel "Die Wildente"1) (1916,
Bassermann als Hjalmar Ekdal) und als Kathrine Stockmann1) in
"Ein
Volksfeind"1) (1916, Bassermann
als Dr. Thomas Stockmann1))
→ ibsenstage.hf.uio.no. Daneben gab sie Gastrollen an etlichen anderen Berliner
Theatern, beispielsweise auch an den "Reinhardt-Bühnen"1),
wo sie unter anderem als Frau Flamm in dem Hauptmann-Drama "Rose Bernd"1)
überzeugen konnte. So schrieb der berühmte Kurt Tucholsky1) in einer Kritik in
der Wochenzeitschrift "Die Weltbühne"1)
(07.08.1919; Nr. 33, S. 170): "Sie hat so viel gespielt: das ein wenig krächzende, gebrochene Organ konnte Milde ausdrücken und Schmerz
und Mutterliebe, alles verzeihende und verschönernde, beschönigende Mutterliebe. Und sie starb nicht als
Peer Gyntens Mutter: sie erlosch. (…) Und das ist das Letzte aller Schauspielkunst, ist Ingenium.
Ich habe ihr einmal in die Augen gesehen:
sie sahen gütig und doch durchdringend in die bunte Welt, Und weil sie von unsern Besten ist, laß mich
ihr –heute noch – eine Blume geben, die der jugendliche Verliebte sonst wohl seiner Siebzehnjährigen
scheu an die Brust heftet: eine dunkle rote Rose."2)
In den 1920er Jahre gestaltete Ilka Grüning in Berlin unter anderem die
Marthe Schwerdtlein in Goethes "Faust I"1)
(1922, "Lessingtheater", Regie: Victor Barnowsky) an der
Seite von Theodor Loos
als Faust,
Emil Jannings
als Mephisto und
Käthe Dorsch
als Gretchen, die Gertrud Deuter in der Komödie "Die
Hose"1) von Carl Sternheim1)
(1923, "Tribüne"1);
Regie: Eugen Robert1))
und die Titelrolle der bigotten, raffgierigen Witwe Eva Bonheur in dem
Drama "Eva Bonheur" (1926) des Niederländers Herman
Heijermans1) (1926, "Central-Theater"1),
Regie: Hans Felix). Am "Deutschen
Theater"1) erlebte man sie unter
der Regie von Heinz Hilpert1)
als die Witwe Frau von Wieg in dem Schauspiel "Die
Verbrecher" (1928) von Ferdinand Bruckner1)
(→ TV-Film 19641)),
an der "Komödie
am Kurfürstendamm" als Arztwitwe in dem von Gustaf Gründgens
inszenierten Lustspiel "Wann kommst du wieder?" (1929;
"Penelope") von W. Somerset Maugham1)
→ Auszug
Wirken am Theater
bei Wikipedia
Seit Ende der 1910er Jahre stand Ilka Grüning regelmäßig vor der Kamera
und etablierte sich mit prägnanten Rollen der Salondame oder Mutter zu
einer vielbeschäftigten Darstellerin im Stummfilm. Bereits 1912 hatte
sie mit dem kurzen Streifen "Die Kunst des Schminkens" erste
Erfahrungen mit dem neuen Medium Film gesammelt.
Ilka Grüning um 1900 auf einer Künstlerkarte,
aufgenommen im Fotoatelier "Becker & Maass", Berlin
(Otto Becker (1849–1892)/Heinrich Maass (1860–1930))
Quelle: Wikimedia Commons;
Angaben zur Lizenz (gemeinfrei)
siehe hier |
 |
|
Ihr bevorzugtes Metier waren
Historienfilme und anspruchsvolle Literaturverfilmungen, in denen sie
oftmals in ihren Bühnenrollen besetzt wurde, aber auch in den Melodramen
jener Jahre fand sie ihren Platz. So gestaltete sie in der zweiteiligen
Stummfilm-Version von Ibsens "Peer Gynt"1) (1919; Regie:
Victor Barnowsky1)) auch
auf der Leinwand neben dem Titelhelden Heinz Salfner
die Mutter Aase oder zeichnete die Frau Flamm in der Hauptmann-Adaption "Rose Bernd"1) (1919; Regie:
Alfred Halm1)) an der Seite von
Henny Porten.
|

|
Als Max Mack1)
mit "Figaros Hochzeit" (1920) die Komödie "La
folle journée, ou le Mariage de Figaro"1)
von Beaumarchais1)
mit Alexander Moissi als Figaro
und Hella Moja als Chérubin auf die Leinwand bannte,
besetzte er Ilka Grüning als Bedienstete Marcelline, in dem von
(Regie) und mit Reinhold
Schünzel in Szene gesetzten Historienfilm "Katharina die Große"1) (1920)
gab sie die Fürstin von Anhalt-Zerbst1),
Mutter der russischen Zarin Katharina II.1).
In dem opulenten, mit rund 4.000 Darstellern bzw. Statisten gedrehten
monumentalen Portrait über die berühmte Katharina II., dargestellt
von Lucie Höflich, spielte Schünzel den russischen Thronfolger Großfürst
Peter Fjodorowitsch, den späteren Zaren Peter III.1),
den die damals 14-jährige Katharina 1746 heiratete, Fritz Kortner
Katharinas Günstling, den Reichsfürsten Gregor Potjomkin1).
In weiteren Rollen zeigten sich unter anderem Gustav Botz1) (Großkanzler
Graf Alexei Bestuschew1)),
Hugo Flink (Katharinas Liebhaber Sergej Saltikow1)),
Fritz Delius (Katharinas Liebhaber Gregor Graf
Orlow1)) und Mechthildis Thein
(Geliebte des Thronfolgers Peter, Fürstin Elisabeth Romanowna Woronzowa1)).
Ilka Grüning auf einer Fotografie
des Fotoateliers
"Zander & Labisch", Berlin
Urheber Siegmund
Labisch1) (1863–1942)
Quelle: cyranos.ch; Angaben zur Lizenz
(gemeinfrei)
siehe hier
|
Und immer wieder waren es die beachtenswerten Mutter-Rollen, etwa des jungen
Conte Marino Marco (Paul Hartmann) in dem Melodram "Der Roman der Christine von Herre"1) (1921)
nach der Novelle von Heinrich Zschokke mit Agnes Straub in der Titelrolle
und Werner Krauß als deren
grausamer Gatte Graf von Herre,
des französischen Revolutionärs Saint Just1)
(Wilhelm Dieterle) in der Literaturverfilmung
"Es leuchtet meine Liebe"3) (1922)
nach der Novelle "Malmaison" von Annemarie von Nathusius1) mit
Mady Christians als Marquise von Chateletder, der Rosalinde
(Eva May) in "Die Fledermaus"1) (1923)
nach dem Libretto von Karl Haffner1)
und Richard Genée1) zur gleichnamigen
Operette1) von Johann Strauss1) oder
der Mutter Steyer in Friedrich Wilhelm Murnaus1)
Adaption "Die
Austreibung"1) (1923) mit dem Untertitel "Die Macht der zweiten Frau"
nach dem Theaterstück von Carl Hauptmann1).
Murnau hatte sie bereits in seiner Verfilmung "Phantom"1) (1922)
nach dem gleichnamigen
Roman1) von Gerhart Hauptmann1) neben Protagonist
Alfred Abel als die "Baronin" besetzt,
später mimte sie die Köchin Augustina in Murnaus Komödie "Die
Finanzen des Großherzogs"1) (1924),
gedreht nach dem Roman "Storhertigens Finanser" von Frank Heller1)
mit Harry Liedtke als
Don Ramon XXII., Großherzog von Abacco. Für
Berthold Viertel1) war sie Noras alte Amme in der
Verfilmung "Nora"1) (1923)
nach dem gleichnamigen
Theaterstück1) von Henrik Ibsen1) mit
Olga Tschechowa in der weiblichen Hauptrolle,
für Curt Goetz
stellte sie als Elisabetha Dorothea1)
die Ehefrau des von Max Pategg1) gespielten Johann Kaspar Schiller1)
dar, Eltern des Dichterfürsten Friedrich Schiller1),
in dem lange als verschollen geltenden Streifen "Friedrich
Schiller – Eine Dichterjugend"1) (1923)
mit Theodor Loos in der Titeltrolle. Mehrfach arbeitete sie mit
dem legendären Regisseur Georg Wilhelm Pabst1) zusammen, der sich Ilka Grünings
eindringliches Spiel zunutze machte
und sie in seinen meisterlichen Stummfilmen besetzte: So als Ehefrau des alten Glockengießermeisters (Albert Steinrück) in dem Drama "Der Schatz"1) (1923)
nach einer Novelle von Rudolf Hans Bartsch1),
als Ehefrau des Generaldirektor Rosenow (Karl Etlinger1)) in
dem berühmten Klassiker "Die
freudlose Gasse"1) (1925)
nach dem Roman von Hugo Bettauer1) mit unter
anderem Werner Krauß
und Greta Garbo sowie als
Mutter des von Albträumen geplagten Chemikers Martin Fellman (Werner Krauß) in
dem Drama "Geheimnisse
einer Seele"1) (1926).
Einmal mehr als Mutter, diesmal des lungenkranken Simche Regierer (Curt Bois), zeigte sie sich in dem
von Richard Oswald1) nach einem Illustrierten-Roman
von Ludwig Wolff1)
mit Hans Stüwe gedrehten Drama "Dr. Bessels Verwandlung"1) (1927), zu ihren letzten
Arbeiten für den Stummfilm zählte die der
Vermieterin in Friedrich Zelniks
Krimi "Der
rote Kreis"1) (1929),
einer frühen Verfilmung des Romans "The Crimson Circle" von Edgar Wallace1) → Übersicht
Stummfilme.
Im frühen deutschen Tonfilm war Ilka Grüning nur in zwei Produktionen auf
der Leinwand präsent: In dem von Hanns Schwarz1)
mit Dita Parlo und
Willy Fritsch
in Szene gesetzten Melodram "Melodie des Herzens"1) (1929)
mimte sie das Fräuleins Czibulka,
in der von Max Neufeld
nach dem Bühnenstück von Hans Mahner Mons (1883 – 1956) realisierten, satirischen Komödie "Hasenklein kann nichts dafür"1) (1932) tauchte sie als Minna, Ehefrau des
Schneidermeister Titus Hasenklein (Jakob Tiedtke)
bzw. Mutter von Trude (Lien Deyers), auf.
Seit den 1920er Jahren leitete die Schauspielerin neben ihrer umfangreichen
Arbeit für Theater und Film gemeinsam mit Lucie Höflich
(1883 – 1956) in Berlin eine eigene Schauspielschule. Etliche
renommierte Theater- und Filmgrößen wie Brigitte Horney,
Lilli Palmer,
Inge Meysel,
Erna Sellmer,
Rose Renée Roth,
Horst Caspar oder
Fred Döderlein
erwarben sich dort ihr darstellerisches Rüstzeug.
Mit der so genannten "Machtergreifung"1) der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 beschränkte sich Ilka Grüning in der folgenden Zeit
gezwungenermaßen auf ihre Lehrtätigkeit, 1934 wurde die im
Nazi-Jargon als "Volljüdin" bezeichnete Künstlerin aus der "Reichstheaterkammer"1) (RTK) und "Reichsfilmkammer"1) ((RFK)
ausgeschlossen, was faktisch einem Berufsverbot gleichkam.
1938 verließ Ilka Grüning Deutschland und ging zunächst nach Frankreich,
wo sie am 8. Dezember 1938 in Paris anlässlich einer Gedenkveranstaltung
für Ödön von Horváth^1) aus dessen Schriften rezitierte; auch die vor den
Nazis nach Paris geflohenen Künstler Leon Askin1),
Margarete Hruby1)
und deren Ehemann Manfred Fürst1)
wirkten bei dieser Aufführung mit. Anfang Februar 1939 entschloss sich Ilka Grüning für eine Emigration in die USA,
ihr Bruder Bernhard Grünzweig blieb in Europa (Brüssel1)) zurück.4)
Wie etliche andere aus Nazi-Deutschland geflohene Schauspielerkollegen/-kolleginnen fand
auch Ilka Grüning durch Unterstützung des "European Film Fund"1)
ab Anfang der 1940er Jahre in verschiedenen Anti-Nazi-Produktionen Beschäftigung,
meist waren es jedoch nur kleine bis kleinste Rollen als resolute ältere
Dame, Ehefrau oder Tante. In nachhaltigste Erinnerung ist die damals über 65-Jährige
mit ihrer Figur der Einwanderin Frau Leuchtag geblieben, die in dem von Michael Curtiz
mit Humphrey Bogart
und Ingrid Bergman gedrehten Film-Klassiker "Casablanca"1) (1942)
gemeinsam mit ihrem Mann (Ludwig Stössel)
in "Rick's Café Américain" sitzt und vor dem Barkeeper Carl (Szöke Szakall) ihre ersten Englischkenntnisse zum Besten geben. Die kurze Szene
ist einfach köstlich, Stössel (Mr. Leuchtag) fragt nach der Uhrzeit: "Liebchen – sweetnessheart, what
watch?", sie antwortet "Ten watch", was ihr Mann wiederum mit
der Frage "Such watch?" beantwortet. Gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler
Ludwig Stössel spielte
Ilka Grüning unter anderem auch in dem von Sam Wood1) nach dem Bestseller von Henry Bellmann (1882 – 1945) inszenierten,
"Oscar"-nominierten Streifen
"Kings Row"1) (1942; u. a. mit
Ronald Reagan),
in dem Sonja Henie1)-Filmmusical
"Iceland" (1942),
in dem Propagandafilm "The Strange Death of Adolf Hitler"1) (1943; Drehbuch:
Fritz Kortner/Joe May1)) sowie
in dem Thriller "Temptation" (1946) nach dem Theaterstück
"Bella Donna" von James B. Fagan (1873 – 1933) bzw. nach dem Roman von
Robert Smythe Hichens (1864 – 1950), wo
Stössel/Grüning erneut ein altes Ehepaar gaben.
Letztmalig traten sie zusammen in Robert Siodmaks1)
Adaption "Der Spieler"1) (1948,
"The Great Sinner") nach dem gleichnamigen
Roman1) von Fjodor Dostojewski1) neben
Gregory Peck
("Spieler" Fedja) und Ava Gardner
(Pauline Ostrovsky) auf der Leinwand in Erscheinung –
Grüning mimte Paulines Anstandsdame, Stössel einen Hotelmanager.
Zu Ilka Grünings Arbeiten in Hollywood zählte unter der Regie
von Max Ophüls1)
die Verfilmung "Brief einer Unbekannten"1) (1947,
"Letter From an Unknown Woman") nach der gleichnamigen
Novelle1)
von Stefan Zweig1) mit
Joan Fontaine und Louis Jourdan sowie
der Film noir1) "Gefangen"1) (1949,
"Caught") nach dem Roman "Wild Calendar" von Libbie Block (1910 – 1972) mit
James Mason
und Barbara Bel Geddes1), wo sie
mit dem kleinen Part der Großmutter Rudetzki auftrat. In Billy Wilders1),
unter anderem mit Marlene Dietrich
gedrehten Romanze bzw. Dreiecksgeschichte "Eine auswärtige Affäre"1) (1948,
"A Foreign Affair") musste sie sich mit der winzigen Rolle
einer deutschen Frau begnügen, in dem Krimi "Der
Mann, der zu Weihnachten kam"1)
(1949, "Mr. Soft Touch") mit der einer alten Frau. Bis zu ihrer zeitweiligen Rückkehr nach Europa im Jahre 1950 drehte Ilka Grüning noch
wenige Filme in den USA, stand
zuletzt in Hollywood als Mrs. Polanski für das Melodram "Die
Ehrgeizige"1) (1950, "Payment on Demand")
neben den Protagonisten Bette Davis
und Barry Sullivan1) sowie als Frau von "Papa" Emil Ludwig (Griff Barnett1)) für das Western-Drama "Die Faust der Vergeltung"1) (1951,
"Passage West") vor der Kamera → Übersicht Tonfilme in den USA.
Im Rahmen einer Gastspielreise besuchte die Schauspielerin 1950 auch
Deutschland, übernahm unter der Regie von Leonard Steckel in der schweizerischen Produktion "Die Venus vom Tivoli"1) (1953)
an der Seite von Hilde Krahl,
Paul Hubschmid
und Heinrich Gretler
als Frau Stransky letztmalig eine Aufgabe in einem Kinofilm → cyranos.ch.
Ihren Lebensabend verbrachte
Ilka Grüning, die seit 24. Mai 1948 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft
besaß, in den Vereinigten Staaten, dort starb sie am 14. November 1964 im
Alter von 88 Jahren in Los Angeles1) (Kalifornien). Nach der Einäscherung
wurde die Urne mit ihren sterblichen Überresten im "Columbarium of Faith" (Nische 567-2) auf dem
"Woodlawn
Memorial Cemetery"1) im
kalifornischen Santa Monica1) beigesetzt.
Ilka Grüning als Frau Stransky in dem Film "Die Venus vom Tivoli"
(1953)
Quelle/Link: cyranos.ch
bzw. Archiv "Praesens-Film AG", Zürich,
mit freundlicher Genehmigung von Peter Gassmann (Praesens-Film
AG, Zürich)
© Praesens-Film AG
|
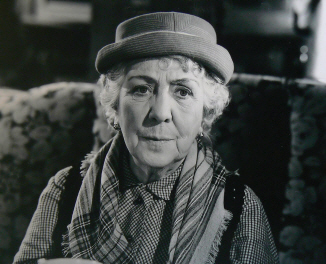 |
|
*) Ludwig
Eisenberg: Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert
(Verlag von Paul List, Leipzig 1903);
Digitalisiert: Ilka Grüning: S. 362
**) Weitere Quellen:
- Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933 – 1945;
Herausgeber: Frithjof Trapp, Werner Mittenzwei, Henning Rischbieter,
Hansjörg Schneider;
Band 2: Biographisches Lexikon der Theaterkünstler von Frithjof Trapp,
Bärbel Schrader, Dieter Wenk, Ingrid Maaß (Teil 1,
A-K; K G Saur, München 1999)
- Kay
Weniger: "Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben…"; Lexikon der aus Deutschland und Österreich
emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945
(ACABUS Verlag, Hamburg 2011, S. 220)
Fremde Links: 1) Wikipedia (deutsch), 3) Murnau
Stiftung, 5) wunschliste.de
2) vollständiger Text bei www.textlog.de
4) Kay Weniger: "Es wird im Leben dir mehr genommen als
gegeben…"; Lexikon der aus Deutschland und Österreich
emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945
(ACABUS Verlag, Hamburg 2011, S. 220)
Lizenz Abbildung Ilka Grüning (Urheber:
Jan Vilímek): Diese Bild- oder Mediendatei ist
gemeinfrei, weil
ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Das gilt in der EU und solchen Ländern, in denen das Urheberrecht 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers erlischt.
Lizenz Foto Ilka Grüning (Urheber:
Fotoatelier Becker & Maass, Berlin (Otto Becker (1849–1892) /
Heinrich Maass (1860–1930)): Dieses Werk ist gemeinfrei,
weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das
Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen
Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.
Lizenz Foto Ilka Grüning (Urheber "Fotoatelier Zander & Labisch",
Berlin): Das Atelier von Albert Zander und Siegmund
Labisch († 1942) war 1895 gegründet worden; die inaktive
Firma wurde 1939 aus dem Handelsregister gelöscht. Externe Recherche
ergab: Labisch wird ab 1938 nicht mehr in den amtlichen
Einwohnerverzeichnissen aufgeführt, so dass sein Tod angenommen werden
muss; Zander wiederum war laut Aktenlage ab 1899 nicht mehr aktiv am
Atelier beteiligt und kommt somit nicht als Urheber dieses Fotos in Frage.
Die Schutzdauer (von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers) für das von
dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen
und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.
(Quelle: Wikipedia)
|
Filme
Stummfilme / Tonfilme
Filmografie bei der Internet Movie Database,
filmportal.de
sowie
frühe Stummfilme bei "The
German Early Cinema Database"
(Fremde Links: Murnau Stiftung, Wikipedia, filmportal.de, theaterwissenschaft.ch; R
= Regie)
|
Stummfilme
- 1912: Die Kunst des Schminkens
(R: ?; als das Mädchen) → Early Cinema Database
- 1919: Peer Gynt
(nach dem gleichnamigen dramatischen
Gedicht von Henrik
Ibsen; R: Victor
Barnowsky;
mit Heinz
Salfner als Peer Gynt; als Aase, Peers Mutter)
- 1919: Die Prostitution – Teil 2: Die sich verkaufen
(R: Richard
Oswald; als die ein Doppelleben führende Frau Bürger)
- 1919: Pogrom
(R: Alfred
Halm; als Wera Cheberiak) → Early Cinema Database
- 1919: Rose Bernd
(nach dem
gleichnamigen Drama von Gerhart
Hauptmann; R: Alfred
Halm; mit Henny
Porten
in der Titelrolle; als Henriette Flamm, Frau des Dorfschulzen Christoph Flamm,
Roses Liebhaber (Alexander Wierth; 1875–nach 1902) → filmportal.de
- 1919: Todesurteil (R: Martin
Berger; als Mutter) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1919: Aladin und die Wunderlampe
(R/Produktion: Hans
Neumann; als ?) → Early Cinema Database
- 1919/20: Menschen
(R: Martin Berger; als die Mutter) → Early Cinema Database
- 1920: Monica Vogelsang
(nach dem Werk von Felix
Philippi; R: Rudolf
Biebrach; mit Henny
Porten
in der Titelrolle; als Mutter des leichtsinnigen, im Hause
Vogelsang angestellten Tagediebs
Johannes Walterspiel (Ernst
Deutsch))→ Murnau Stiftung
- 1920: Maria
Magdalene (nach dem Trauerspiel "Maria
Magdalena" von Friedrich
Hebbel; R: Reinhold
Schünzel
(auch Rolle des Leonhard) mit Lucie
Höflich als Klara, Tochter von Meister Anton (Eduard
von Winterstein);
als dessen Ehefrau/Klaras Mutter)
- 1920: Der Gefangene. Sklaven des XX. Jahrhunderts (nach der Vorlage von Paul
Oskar Höcker; R: Carl Heinz
Wolff; als ?)
→ IMDb,
Early Cinema Database
- 1920: Demimonde-Ehe
/ Eine Demimonde-Heirat (nach dem Schauspiel von Émile
Augier; R: Martin
Zickel; mit Lya
Mara
als Lebedame Iza; als deren Mutter Anuschka) → Early Cinema Database
- 1920: Das Grauen
/ Im Taumel der Leidenschaft (nach einer Vorlage von Toni Dathe;
R: Fred Sauer; als Mutter von
Fred Claar (Friedrich Zelnik))
→ Early Cinema Database
- 1920: Können Gedanken töten?.
Gefesselte Menschen (R: Alfred
Tostary; als Bäuerin) → IMDb,
Early Cinema Database
- 1920: Figaros Hochzeit
(nach der Komödie "La
folle journée, ou le Mariage de Figaro" von Beaumarchais;
R: Max Mack;
mit Alexander
Moissi als Figaro, Hella
Moja als Chérubin, erster Page des Grafen Almaviva (Eduard
von Winterstein);
als Bedienstete Marcelline)
- 1920: Die Erlebnisse der berühmten Tänzerin Fanny Elßler
(R: Frederic
Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara
als Fanny Elßler; als
?)→ IMDb
- 1920: Der Abenteurer von Paris (nach dem Roman von Otto
Pietsch; R: Fred
Sauer; mit Frederic Zelnik; als ?) → IMDb
- 1920: Katharina die Große
(von (Regie) und mit Reinhold
Schünzel als Zar Peter
III.; Lucie Höflich als dessen
Gemahlin, die spätere russische Kaiserin Katharina
II.; als Katharinas Mutter, die Fürstin
von Anhalt-Zerbst)
→ filmportal.de
- 1920: Der Sklave seiner Leidenschaft (R: Eberhard Frowein;
als ?) → IMDb
- 1920/21: Christian Wahnschaffe (nach dem Roman von Jakob
Wassermann; R: Urban
Gad; mit Conrad
Veidt
als Christian Wahnschaffe; als ?)
- 1921: Diktatur des Lebens - 2. Teil: Die
Welt ohne Liebe
(R: Fred
Sauer; als Mutter von Ruth Leyden (Esther
Carena))
→ Early Cinema Database
- 1921: Die Bestie im Menschen
(nach dem Roman "La
Bęte Humaine"
von Émile
Zola; R: Ludwig
Wolff;
mit Ossip Runitsch als der Lokführer Jacques Lantier; als ?)
→ IMDb
- 1921: Die Schuldige
(nach dem Roman von Richard Voß; R: Fred Sauer; als Gräfin
Wuthenow; Esther Carena
als Fräulein Joachim von Wuthenow) → IMDb
- 1921: Der Schicksalstag
(R: Adolf
Edgar Licho; als die Gräfin)
- 1921: Die Erbin von Tordis
(R: Robert
Dinesen; mit Ica
von Lenkeffy in der Titelrolle; als Ehefrau
des Oberst von Ingenhofen (Adolf
Klein)) → Murnau Stiftung
- 1921: Hannerl und ihre Liebhaber
(nach dem Roman "Die Geschichte von der Hannerl und
ihren Liebhabern"
von Rudolf
Hans Bartsch; R: Felix
Basch (auch Darsteller); mit dessen Ehefrau Grete
Freund-Basch als Hannerl Thule;
als ?) → IMDb
- 1921: Die
große und die kleine Welt (nach der Komödie von Rudolf
Eger; R: Max
Mack; als Frau aus dem Volke)
- 1921: Der Leidensweg einer Achtzehnjährigen / Ketten der Leidenschaft (R: Eberhard Frowein;
als ?) → IMDb
- 1921: Aus den Tiefen der Großstadt (nach dem Roman
"Jenseits von Gut und Böse" von Luise
Westkirch;
R: Fred
Sauer; als ?) → IMDb
- 1921: Die Verschwörung zu Genua
(nach Motiven des Schiller-Dramas;
R: Paul
Leni; mit Hans
Mierendorff als Fiesco,
Graf von Lavagna, der Kopf der Verschwörer und u. a. Fritz
Kortner als Gianettino Doria; als Matrone) → filmportal.de
- 1921: Die Fremde aus der Elstergasse (R: Alfred
Tostary; mit Margit
Barnay; als ?) → IMDb
- 1921: Um den Sohn (nach dem Roman von Artur
Landsberger; R: Frederik Larsen; als ?) → IMDb
- 1921: Seefahrt ist Not
(nach dem gleichnamigen
Heimatroman von Gorch
Fock (R: Rudolf
Biebrach (auch Darsteller);
als die alte Sill)
- 1921: Trix, der Roman einer Millionärin (R: Frederic
Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara;
als ?) → IMDb
- 1921: Lotte Lore
(nach dem Roman von Wilhelmine
Heimburg; R: Franz
Eckstein; Drehbuch: Rosa
Porten; als ?)
- 1921: Aus den Memoiren einer Filmschauspielerin
(R: Frederic
Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya Mara; als ?) → IMDb
- 1921: Das zweite Leben
(R: Alfred
Halm; als ?)
- 1921: Der Roman der Christine von Herre
(nach der Novelle von Heinrich
Zschokke; R: Ludwig
Berger; mit
Agnes
Straub als Gräfin Christine von Herre; Werner
Krauß als deren Gatte, der grausame Graf von Herre;
als die alte Gräfin Marco, Mutter des Grafen Marino Marco (Paul
Hartmann)) → Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1921: Lady Hamilton (nach
Vorlagen von Heinrich Vollrath Schumacher (1861–1919); R: Richard
Oswald;
mit Liane
Haid als Lady Emma
Hamilton, Conrad
Veidt als Lord Horatio
Nelson; als eine Wirtin)
→ filmportal.de,
stummfilm.at
- 1921: Aus den Erinnerungen eines Frauenarztes – 2. Teil: Lüge und Wahrheit
(R: Lupu
Pick; als ?)
- 1922: Die Dame und der Landstreicher (nach dem
Roman von Werner
Scheff; R: Alfred
Halm; als ?) → IMDb
- 1922: Die siebente Nacht
(R: Arthur
Teuber; mit Margit
Barnay als Miß Maud, eine reiche Amerikanerin;
als Frau Freese, Mutter von Zeitungsbote/Radrennfahrer Franz (Franz
Krupkat)) → www.dhm.de
- 1922: Die Kreutzersonate
(nach dem gleichnamigen
Roman von Leo
Tolstoi; R: Rolf Petersen; mit Alphons
Fryland
als der Geiger Dimitri Truchatschewski, Frederic
Zelnik als Posdnyschew; als Frau Suchoff) → Wikipedia (englisch)
- 1922: Wem nie durch Liebe Leid geschah
(R: Heinz
Schall; als ?)
- 1922: Es leuchtet meine Liebe
(nach der Novelle "Malmaison" von Annemarie
von Nathusius; R: Paul
Ludwig Stein;
mit Wilhelm
Dieterle als französischer Revolutionär Saint
Just, Geliebter von Jeanne, Marquise von Chatelet (Mady
Christians);
als Mutter von Saint Just)
- 1922: Die Macht der Versuchung
(R: Paul Ludwig Stein; als Mutter des Marquis Crespa (Paul
Otto))
- 1922: Jenseits des Stromes
(R: Ludwig
Czerny; als ?)
- 1922: Luise Millerin
(nach dem Drama "Kabale
und Liebe" von Friedrich
Schiller; Regie: Carl
Froelich; mit Lil
Dagover als
Luise Millerin, Paul
Hartmann als Major Ferdinand von Walter; als Frau Miller, die Frau des Stadtmusikanten
Miller (Fritz
Kortner), Eltern von Luise)
- 1922: Jugend
(nach dem gleichnamigen
Drama von Max
Halbe; R: Fred
Sauer (auch Drehbuch); als Maruschka)
- 1922: Tiefland
(nach dem Bühnenstück "Terra baixa" von Ŕngel
Guimerŕ bzw. dem Libretto von Rudolph
Lothar zu
der Oper "Tiefland"
von Eugen
d'Albert; R: Adolf
Edgar Licho; mit Michael
Bohnen als Sebastiano, ein reicher
Grundbesitzer, Lil
Dagover als Martha;
als die Duenna)
- 1922: Der große Wurf
(R: Joseph Max Jacobi, Georg
Jacoby; als Kommerzienrätin Frau Steinreich)
- 1922: Das hohe Lied der Liebe (R: Heinz
Schall; als ?) → IMDb
- 1922: Phantom
(nach dem gleichnamigen
Roman von Gerhart
Hauptmann; R: Friedrich
Wilhelm Murnau;
als die "Baronin") → Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1922: Bigamie (nach dem Drama "Der lebende
Leichnam" von Leo
Tolstoi; R: Rudolf
Walther-Fein; mit Alfred
Abel
als Fedja, Margit
Barnay als dessen Frau Lisawetha; als ?) → Wikipedia (englisch);
siehe auch Verfilmung 1929
sowie projekt-gutenberg.org
- 1922: Der falsche Dimitry.
Ein Zarenschicksal (basierend auf den geschichtlichen
Ereignissen, wie sie sich in
dem Drama "Boris
Godunow" von Alexander
Puschkin, dem Dramen-Fragment "Demetrius"
von Friedrich
Schiller und
dem Dramen-Fragment "Demetrius"
von Friedrich
Hebbel darstellen; R: Hans
Steinhoff; mit Alfred
Abel als
Zar Iwan
der Grausame, Eugen
Klöpfer als Boris
Godunow; als Amme Pawlowa)
- 1922: Das Weib auf dem Panther
(R: Alfred
Halm; mit Grete
Reinwald; als ?)
- 1922: Zwei
Welten (R: Richard
Löwenbein; als Eheftau von Rechnungsrat Möller (Ludwig
Hartau))
- 1923: Die Fledermaus
(nach dem Libretto von Karl
Haffner und Richard
Genée zur gleichnamigen
Operette von
Johann
Strauss; R: Max
Mack; als Mutter von Rosalinde (Eva
May))
- 1923: Der Menschenfeind
(R: Rudolf
Walther-Fein; als ?)
- 1923: Freund Ripp (R: Alfred
Halm; als ?) → IMDb
- 1923: Das schöne Mädel
(nach dem Roman von Georg
Hirschfeld; R: Max
Mack; als Frau des alten Gött (Fritz
Richard);
Hella Moja und Margit
Barnay als deren Töchter, Walter Rilla als deren Sohn) → Wikipedia (englisch)
- 1923: Friedrich
Schiller – Eine Dichterjugend (R: Curt
Goetz; mit Theodor
Loos als Friedrich
Schiller; als Friedrichs Mutter
Elisabetha
Dorothea Schiller, Ehefrau von Johann
Caspar Schiller (Max
Pategg)) → filmportal.de
- 1923: Der Schatz
(nach einer Novelle von Rudolf Hans Bartsch;
R: Georg
Wilhelm Pabst; als Anna, Frau des
Glockengießers Svetocar Badalic (Albert
Steinrück), Eltern von Beate (Lucie
Mannheim)) → filmportal.de
- 1923: Nora
(nach dem gleichnamigen
Theaterstück von Henrik
Ibsen; R: Berthold
Viertel; mit Olga
Tschechowa
in der Titelrolle der Nora;
als Marianne, Noras alte Amme) → Murnau Stiftung
- 1923: Katjuscha Maslowa
/ Auferstehung (nach dem Roman "Auferstehung"
von Leo
Tolstoi; R: Friedrich
Zelnik;
mit dessen Ehefrau Lya
Mara in der Titelrolle; Rudolf
Forster als Fürst Dimitri Nechludow; als dessen erste Tante)
- 1923: Der rote Reiter
(nach dem Roman von Franz
Xaver Kappus; R: Franz
W. Koebner; mit Fern
Andra (auch Produktion)
als Hasia von Nawroska (Zuordnung unsicher);
als ?)
- 1923: Daisy. Das Abenteuer einer Lady R: Friedrich
Zelnik; mit dessen Ehefrau Lya
Mara in der Titelrolle; als ?) → IMDb
- 1923: Die
Austreibung. Die Macht der zweiten Frau (nach dem
Theaterstück von Carl
Hauptmann;
R: Friedrich
Wilhelm Murnau; mit Wilhelm
Dieterle als Jäger Lauer, Geliebter von Ludmilla Steyer (Aud
Egede-Nissen),
der zweiten Frau des Steyer-Sohns (Eugen
Klöpfer); als Mutter Steyer) → Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1924: Kaddisch
(R: Adolf
Edgar Licho; als ?)
- 1924: Das Geschöpf
(R: Siegfried
Philippi; als ?) → IMDb
- 1924: Die
Finanzen des Großherzogs (nach dem Roman
"Die Finanzen des Großherzogs" ("Storhertigens
Finanser")
von Frank
Heller; R: Friedrich
Wilhelm Murnau; mit Harry
Liedtke als Don Ramon XXII., Großherzog von Abacco;
als Köchin Augustina) → Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1924: Gehetzte Menschen
(R: Erich
Schönfelder; als Gattin des Reeders F.A. Mertens (Rudolf
Lettinger),
Eltern von Hans (Johannes
Riemann); Hans
Albers als Karl von Behn, Hauptkassierer der Reederei)
- 1924: Mater Dolorosa
(R: Joseph
Delmont; als ?) → IMDb
- 1924: Soll und Haben
(nach dem gleichnamigen
Roman von Gustav
Freytag; R: Carl
Wilhelm; als Madame Sidonie,
Ehefrau von Makler Hirsch Ehrenthal (Robert
Garrison)) → filmportal.de
- 1924: Die Liebesbriefe einer Verlassenen
(R: Emmerich
Hanus; als ?)
- 1925: Des Lebens Würfelspiel
(R: Heinz
Paul; als Frau von Wilhelm Päsche (Wilhelm
Diegelmann))
- 1925: Die
freudlose Gasse (nach dem Roman von Hugo
Bettauer; R: Georg
Wilhelm Pabst; als Gemahlin von
Generaldirektor Rosenow (Karl
Etlinger)) → filmportal.de
- 1925: Elegantes Pack
(R: Jaap
Speyer; als Mutter von Rechtsanwalt Dr. Leo Bärenreither (Johannes
Riemann))
- 1926: Geheimnisse
einer Seele (R: Georg
Wilhelm Pabst; als Mutter von Chemiker Martin Fellman (Werner
Krauß))
→ Murnau Stiftung,
filmportal.de
- 1926: Hallo Caesar!
(von (Regie) und mit Reinhold
Schünzel als Jongleur Caesar; als dessen Zimmerwirtin Frau
Svoboda,
Mutter von Rosl (Toni Philippi)) → filmportal.de
- 1927: Familientag im Hause Prellstein
(nach dem Theaterstück der Brüder Anton (1866–1929) und Donat Herrnfeld (1867–1916),
Betreiber des "Gebrüder-Herrnfeld-Theater"; R:
Hans
Steinhoff; als Seraphine) → filmportal.de,
viennale.at
- 1927: Dr. Bessels Verwandlung
(nach einem Illustrierten-Roman von Ludwig
Wolff; R: Richard
Oswald; mit Hans
Stüwe
als Dr. Alexander Bessel; als Mutter des lungenkranken Simche
Regierer (Curt
Bois)) → stummfilm.at
- 1927: Herbstzeit am Rhein
(R: Siegfried
Philippi; als Frau Holm)
- 1928: Dyckerpotts Erben
(nach der Kleinbürgerkomödie von Robert
Grötzsch; R: Hans
Behrendt; als eine der Erben)
- 1928: Ein
Mädel und drei Clowns – Die drei Zirkuskönige
/ The Three Kings (Produktion Deutschland/Großbritannien;
R: Hans
Steinhoff; mit Evelyn
Holt; als Wirtin)
- 1929: Der
rote Kreis (nach dem Roman "The Crimson Circle"
von Edgar
Wallace; R: Friedrich
Zelnik; mit dessen
Ehefrau Lya
Mara als Thalia Drummond; als eine Vermieterin)
- 1929: Zwischen vierzehn und siebzehn – Sexualnot der Jugend
(R: E.
W. Emo; als die Frau für "diskrete Fälle")
Tonfilme
- Produktionen in Deutschland
- Produktionen in den USA
- 1941: Underground (R: Vincent
Sherman; mit Jeffrey
Lynn und Philip Dorn (d. i. Frits van Dongen)
als die
gegensätzlichen Brüder Kurt und Eric Franken; als Frau Franken)
→ Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1941: Dangerousley They Live (R: Robert
Florey; als Mrs. Steiner) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1942: Friendly Enemies
(nach dem Theaterstück von Aaron Hoffman (1880–1924) und Samuel Shipman (1883–1937);
R: Allan
Dwan; mit Charles
Winninger als Karl Pfeiffer; als dessen Ehefrau Maria "Mama"
Pfeiffer)
- 1942: Sabotageauftrag
Berlin / Desperate Journey (R: Raoul
Walsh; mit Errol
Flynn und dem späteren
US-amerikanischen Präsidenten Ronald
Reagan; als Ehefrau von Hermann Brahms (Felix
Basch),
Eltern von Käthe Brahms (Nancy
Coleman), Mitglied der Untergrund-Bewegung)
- 1942: King's Row
(nach dem Bestseller von Henry Bellmann (1882–1945); R:
Sam
Wood; als Anna)
- 1942: Iceland (R: H. Bruce Humberstone;
mit Eiskunstläuferin Sonja
Henie als einheimische Schönheit Katina Jonsdottir,
Tochter von Papa Jonsdottir (Felix
Bressart; als Tante Sophie) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1942: Casablanca
/ Casablanca (nach dem Theaterstück "Everybody Comes to Rick's" ("Jeder geht in Ricks Bar")
von Murray Burnett (1910–1997) und Joan Alison (1901–1992);
R: Michael
Curtiz; mit Humphrey Bogart und
Ingrid
Bergman; als Ehefrau von Herrn Leuchtag (Ludwig
Stössel), Emigranten in Ricks Café)
→ Beschreibung
innerhalb dieser HP
- 1943: Madame Curie / Madame Curie
(über die von Greer
Garson dargestellte Physikerin und zweifache
Nobelpreisträgerin
Marie
Curie, basierend auf der gleichnamigen Biografie ihrer
Tochter Čve
Curie; R: Mervyn
LeRoy.;
mit Walter
Pidgeon als Pierre
Curie; als Näherin) → IMDb
- 1943: This is the Army
(nach dem Broadway-Musical
von Irving
Berlin; R: Michael
Curtiz; als Mrs. Twardofsky) → IMDb
- 1943: The Strange Death of Adolf Hitler
(R: James
P. Hogan; mit Ludwig
Donath in der Doppelrolle des Kleinbürgers
Franz Huber und Adolf
Hitler; als ältere Dame der Mittelklasse)
- 1944: Adresse
unbekannt / Address Unknown (nach dem gleichnamigen
Briefroman von Kressmann
Taylor:
R: William
Cameron Menzies; als Großmutter)
- 1944: An
American Romance (R: King
Vidor; als Mrs. Vronsky) → IMDb
- 1945: Murder in the Music Hall / Midnight Melody (R: John English (1903–1969); als Mutter)
→ Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1946: Rendezvous 24 (R: James
Tinling (1889–1967); als Frau Schmidt) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1946: Temptation (nach dem dem Theaterstück "Bella Donna" von James B. Fagan (1873–1933) nach dem
Roman von Robert Smythe Hichens (1864–1950); R: Irving
Pichel; als Frau Müller) → Wikipedia (englisch),
IMDb
- 1947: Repeat Performance (nach dem Roman von William O'Farrell (1904–1962); R: Alfred
L. Werker; als Mattie)
→ Wikipedia (englisch)
- 1947: In der Klemme /
Desperate (R: Anthony
Mann; als Tante Klara)
- 1947: Brief einer Unbekannten
/ Letter From an Unknown Woman (nach der gleichnamigen
Novelle
von Stefan Zweig;
R: Max
Ophüls; mit Joan
Fontaine und Louis
Jourdan; als Kartenabreißerin) → IMDb
- 1948. Flucht
ohne Ausweg / Raw Deal (nach der Erzählung von Arnold B. Armstrong und Audrey Ashley;
R: Anthony
Mann; als Haushälterin von Oscar (Harry Tyler; 1888–1961))
- 1948: Eine auswärtige Affäre
/ A Foreign Affair (R: Billy
Wilder; mit Marlene
Dietrich; als eine deutsche Frau)
→ marlenedietrich-filme.de,
IMDb
- 1948: Words and Music
(R: Norman
Taurog; Musical-Komponisten-Porträt über die
Zusammenarbeit des von
Tom
Drake dargestellten Kompüonisten Richard
Rodgers und des Textautors Lorenz
Hart, gespielt von Mickey
Rooney;
als Mrs. Rogers)
- 1949: Der Spieler /
The Great
Sinner (nach dem gleichnamigen
Roman von Fjodor
Dostojewski; R: Robert
Siodmak;
mit Gregory
Peck als "Spieler" Fedja; als Anstandsdame von Pauline Ostrovsky
(Ava
Gardner)) → IMDb
- 1949: Gefangen / Caught
(nach dem Roman "Wild Calendar" von Libbie Block (1910–1972);
R: Max
Ophüls;
als Großmutter Rudetzki) → IMDb
- 1949: Der
Mann, der zu Weihnachten kam / Mr. Soft Touch (R: Henry
Levin, Gordon
Douglas; mit Glenn
Ford
und Evelyn
Keyes in den Hauptrollen; als alte Frau)
→ IMDb
- 1950: Käpt'n China / Captain China
(R: Lewis
R. Foster; mit John
Payne in der Titelrolle; als Ehefrau von
Mr. Haasvelt (Edgar
Bergen))
- 1950: Verurteilt /
Das Tor zur grauen Hölle/ Convicted (nach dem Theaterstück
"Criminal Code" von
Martin Flavin;
R: Henry
Levin; mit Glenn
Ford in der Hauptrolle; als Martha Lorry) → IMDb
- 1950: Der Ehrgeizige / Payment on Demand
(R: Curtis
Bernhardt; mit Bette
Davis und Barry
Sullivan
in den Hauptrollen; als Mrs. Polanski) → IMDb
- 1951: Die Faust der Vergeltung / Passage West (R: Lewis
R. Foster; als Frau von "Papa" Emil Ludwig (Griff
Barnett))
→ wunschliste.de,
Wikipedia (englisch)
- Produktion Schweiz
|
|

