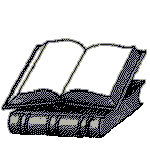Neuigkeiten
|
|||||
|
Archivierte Seiten / Neuigkeiten
Letzte aktuelle Meldung: Rolf Becker ist tot |
|||||
| Wer hilft? |
… bei der Suche nach Informationen zu
einigen Publikumslieblingen sowie bei der Korrektur eventuell inzwischen nicht mehr gültiger Verlinkungen zu externen Webangeboten. Als "Einzelkämpferin" wäre ich für entsprechende Hinweise dankbar. (Kontakt siehe Impressum) Achtung: Weiterhin werden immer noch unbekannte "Gesichter" sowie einzelne Infos gesucht → mehr dazu auf dieser Seite. |
||||
| Besondere Geburtstage im Dezember bzw. erinnerungs- würdige Daten zu legendären Künstlern/ -innen (Fremde Links: Wikipedia |
Zu erinnern ist am … an den … von …
Besondere Geburtstage der vergangenen Monate des Jahres 2025 siehe hier |
||||
| 12.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 14.12.2025 | Am 12, Dezember 2025 starb im Alter von 90 Jahren in
Hamburg nach kurzer, schwerer Krankheit der Schauspieler
Rolf Becker. Der an der renommierten "Otto-Falkenberg-Schule"1)
in München ausgebildete Künstler begann seine Karriere Ende der 1950er Jahre an den
"Münchner Kammerspielen"1),
stand unter anderem am
"Theater Bremen"1)
und am
"Deutschen Schauspielhaus"1)
in Hamburg auf der Bühne, arbeitete beispielsweise mit dem legendären
Regisseu Peter Zadek1) zusammen.
Doch vor allem durch zahllose Film- und Fernsehproduktionen wurde der Mann
mit den markanten Gesichtszügen seit den 1960ern einem breiten Publikum
bekannt und geriet mit prägnanten Rollen auf dem Bildschirm bald zum
Dauergast. Seine Filmografie umfasst rund 200 Produktionen, sei es in
Literaturadaptionen, Krimis, Komödien oder Melodramen – immer wieder konnte
Becker mit seinem Spiel die Zuschauer/-innen für sich gewinnen und prägte
damit maßgeblich die Filmszene. Bis ins hohe Alter bzw. bis fast zuletzt
stand er vor der Kamera, aus der Vielzahl seiner Arbeiten bleibt er vor
allen in jüngerer Zeit mit der Figur des gutmütigen Rentners Otto Stern in dem
Dauerbrenner "In
aller Freundschaft"1) in Erinnerung,
den er seit 2006 bis kurz vor seinem Tod in rund 550 Episoden
mimte. Darüber hinaus war er mit seiner unverwechselbaren Stimme ein begehrter Sprecher sowohl in der
Synchronisation als auch im Hörspiel, hielt zudem immer wieder Lesungen ab.
Der vielseitige Schauspieler engagierte sich zudem politisch und sozial, setzte sich
unter anderem gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Sylvia Wempner1)
für Flüchtlinge überall in der Welt ein. Sein darstellerisches Talent gab der Wahl-Hamburger
und fünffache Vater an seine Kinder Ben Becker1)
(* 1964) und Meret Becker1)
(* 1969) aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerkollegin Monika Hansen1)
(1942 – 2025) weiter, die ebenfalls den Schauspielberuf
ergriffen und sich damit sowohl am Theater als auch im Film einen Namen machten → siehe auch die
Nachrufe unter anderem bei www.ndr.de,
www.zdfheute.de,
www.brisant.de. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 11.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 28.11.2025 |
Am 28. November 2025 starb in ihrem Haus im niedersächsischen Ort Eyendorf1)
in der Lüneburger Heide1) im
Alter von 94 Jahren Ingrid van Bergen, einst eine der berühmtesten
Schauspielerinnen im Nachkriegsdeutschland. Bereits Anfag November berichteen verschiedene Medien,
die einstige Leinwand-Ikone habe ihr
Augenlicht verloren bzw. sei vollständig erblindet. Seit etlichen Jahren
lebte sie in Wohngemeinschaft mit
ihrer engen Freundin aus
der Haftzeit, Linda, auf ihrem Bauernhof. Ingrid van Bergen gehörte zu den
schillernden Pesönlichkeiten jener Nachkriegs-Ära, feierte in
etlichen Kino-Klassikern wie "Des Teufels General"1) (1955),
"Rosen für den Staatsanwalt"1) (1959),
"Wir
Kellerkinder"1) (1960) oder der
Günter Grass1)-Adaption "Katz
und Maus"1) (1967) als Schauspielerin große
Leinwanderfolge. Die attraktive Mimin, meist auf den Typ "femme fatale" festgelegt,
schaffte es bis nach Hollywood, wirkte an der
Seite von Kirk Douglas in dem
Gerichtsfilm "Stadt
ohne Mitleid"1) (1961, "Town Without Pity" sowie in dem
Kriegsstreifen "Verrat
auf Befehl"1) (1962, "The
Counterfeit Traitor") mit. Sie führte ein
bewegtes Leben, in die Schlagzeilen geriet die Künstlerin, als sie in der Nacht vom
2. auf den 3. Februar 1977 im Affekt ihren um zwölf Jahre jüngeren
Freund, den Finanzmakler Klaus Knaths, erschoss. Wegen Totschlags zu
sieben Jahre Freiheitsentzug verurteilt, schien ihre Karriere beendet. Doch
nach ihrer wegen guter Führung vorzeitigen Entlassung Anfang Oktober 1981
konnte sie bald schauspielerisch wieder Fuß fassen, präsentierte sich in etlichen
Kino-Produktionen und Fernsespielen mit, war auch auf der Bühne gefragt
sowie immer wieder ein gern gesehener Gast in Talk-Shows. Mit ihrer
markant-rauchigen Stimme beteiligte sie sich bis in j¨ngere Zeit an Hörspiel-Produktionen und
stand im Synchron-Studio. In Erinnerung bleibt sie nicht zuletzt durch ihre Teilnahme im
RTL-"Dschungelcamp"1) (2009) und vom Publikum zur "Dschungelkönigin"
gekürt wurde → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de,
www.ndr.de,
welt.de,
sueddeutsche.de,
www.faz.net Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 24.11.2025 |
Mit Udo Kier starb am 23. November 2025 im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat
Palm Springs1) (Kalifornien) einer
der wenigen deutschen Schauspieler, die unter anderem regelmäßig in Hollywood-Produktionen auftraten. Spezialisiert vor allem auf
skurrile Nebenrollen, stand er im Laufe seiner beeindruckenden Karriere für rund 300 Kino- und Fernsehfilme
vor der Kamera, zumeist an der Seite großer Stars. "Heimlicher
Weltstar", "Unser Mann in Hollywood", "Dämon des
internationalen Films" oder "König der Nebenrollen" – das
sind nur einige der vielen Titel, mit denen der als Udo Kierspe im Kölner
Stadtteil Mülheim1) geborene Udo Kier im
Verlaufe seiner langen, ungewöhnlichen Karriere belegt wurde. Der Mann mit den grün-blauen
Augen bzw. dem stechenden Blick, der etwas Geheimnisvolles auszustrahlen
schien; sowie dEr markanten Stimme, zählte zu
den schillerndsten Persönlichkeiten der internationalen Filmszene und
blieb bis zuletzt schauspielerisch aktiv. Prägend für Kiers Laufbahn wurden
die Begegnungen bzw. Arbeiten mit Rainer Werner Fassbinder1),
Werner Schroeter1),
Robert van Ackeren1)
sowie dem dänischen Regisseur Lars van Trier1)
und dem Künstler Christoph Schlingensief1).
Vielen galt er nicht nur wegen des
Roadmovies "My
Own Private Idaho"1) (1991) als
herausragender Botschafter des "New Queer Cinema"1)
→ siehe auch die Nachrufe unter
anderem bei tagesschau.de,
zdfheute.de,
www.ndr.de,
taz.de,
stern.de,
www.br.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 18.11.2025 | Die international gefeierten, berühmten, unzertrennlichen Zwillinge Alice und Ellen Kessler schieden selbstbestimmt am 17. November 2025 – nur wenige Monate nach ihrem 89. Geburtstag – in ihrer Villa in Grünwald1) aus dem Leben – laut Medienbeichten durch assistierten Suizid1) in Begleitung einer Ärztin und eines Juristen der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben"1) → tagesschau.de. Sie traten stets gemeinsam als Tänzerinnen, Sängerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen auf, verzeichneten im Laufe ihrer langen Karriere außer im deutschsprachigen Raum insbesondere in Italien, Frankreich und in den USA ungeheure Erfolge. In den 1960er Jahren galten sie als die schönsten Frauen der Welt, begeisterten auch im vorgerückten Alter mit ihren Darbietungen immer wieder das Publikum → siehe auxh die Nachrufe unter anderem bei www.br.de, www.swr.de, www.zeit.de. | ||||
| 15.11.2025 | Am 14. November 2025 starb im
Alter von 86 Jahren in seiner Geburtsstadt Hamburg1) der
Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und
Produzent Hark Bohm. Über Jahrzehnte prägte
der vielseitige Künstler die deutsche Filmszene, wird mit
preisgekrönten, sozialkritischen Coming-Of-Age1)-Produktionen wie
"Tschetan, der Indianerjunge"1) (1973),
"Nordsee
ist Mordsee"1) (1976) oder
"Moritz, lieber Moritz"1) (1978) in nachhaltiger Erinnerung bleiben.
Mit dem mehrfach ausgezeichneten Spielfilm "Yasemin"1) (1988)
schrieb er ebenfalls Filmgeschichte und wurde für diese Regie-Arbeit mit
dem "Filmband
in Gold"1) geehrt. "Er engagierte sich sein
gesamtes Leben für ein unabhängiges deutsches Kino und er gilt als der wichtigste Mentor von Regisseur
Fatih Akin1)." vermerkt
www.ndr.de in einem
Nachruf. "Akin
würdigte seinen Freund und Mentor nun mit liebevollen Worten:
"Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen.
Harks Seele atmet in seinem einzigartigen Werk
weiter", teilte der Regisseur über seine Managerin der Nachrichtenagentur dpa mit."
(Quelle: tagesschau.de) → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei www.welt.de, filmdienst.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 14.11.2025 | Für alle "Loriot"-Fans: Anlässlich des 102. Geburtstages des unvergesslichen
Vicco von Bülow alias
"Loriot"
gab die Leitung des Frankfurter "Caricatura Museum für Komische Kunst"1) bekannt, dass dort
künftig der künstlerische Nachlass von Deutschlands wohl berühmtesten Illustrator und
Komiker präsentiert werde.
Die Dauerleihgabe umfasse unter anderem neben seinen Original-Skizzen auch seine Langspielplatten- und Pfeifensammlung.
So vermeldete tagesschau.de
(12.11.2025): "Große Teile von "Loriots" Nachlass wurden
seit seinem Tod 2011 in der Villa der Familie von Bülow auf dem Anwesen
in Ammerland1) am Starnberger See aufbewahrt, in dem "Loriot" mit seiner Frau Rose-Marie lebte.
Bis zu ihrem Tod (Januar 2025) hatte sich "Loriots" jüngste Tochter, Susanne von Bülow, um das Erbe gekümmert.
Dann sei die Entscheidung gefallen, den Nachlass in "professionelle Hände zu
geben", so
Enkel Leo von Bülow-Quirk.
Dazu gehört auch, dass das "Studio Loriot", das bislang in Berlin angesiedelt war,
ebenfalls schon an den Main umgezogen ist." → mehr bei frankfurt.de
sowie www.faz.net Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 10.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 09.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 24.09.2025 | Ein weiterer Leinwandstar ist von uns gegangen – am 23. September 2025
starb im
Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours1)
nahe Paris die international gefeierte und mehrfach ausgezeichnete, italienische Film-Ikone Claudia Cardinale.
Sie zählte zu den herausragenden Filmdiven ihres Landes, spielte Haupt-
und Nebenrollen in Filmklassikern wie
"Achteinhalb"1) (1963),
"Der Leopard"1) (1963),
"Spiel
mir das Lied vom Tod"1) (1968) oder
"Fitzcarraldo"1) (1982).
Sie prägte mit mehr als 150 Produktionen das europäische Kino und
verzeichnete auch in Hollywood Erfolge. Italiens amtierender Kulturminister Alessandro Giuli bezeichnete Cardinale als "eine der größten italienischen Schauspielerinnen aller Zeiten". Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati1) würdigte die Leinwand-Ikone als eine "Französin im Herzen", deren "Blick, ihre Stimme und ihre Ausstrahlung für immer Teil der Filmgeschichte bleiben werde." Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron1) würdigte Cardinale auf der Social-Media-Plattform "X"1) als einen Star, den "wir Franzosen in der Ewigkeit des Kinos immer in unseren Herzen tragen werden". Die Schauspielerin habe eine Freiheit und ein Talent verkörpert, das von Rom über Hollywood bis nach Paris so viel zu den Werken der Größten beigetragen habe, teilte Macron weiter mit. Und ihr Agent Laurent Savry schrieb einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur "Agence France-Presse"1) (AFP): "Sie hinterlässt uns das Vermächtnis einer freien und inspirierten Frau – als Frau wie auch als Künstlerin." → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei www.zeit.de, spiegel.de, tagesschau.de, zdfheute.de, sueddeutsche.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 17.09.2025 | Mit Robert Redford starb
am 16. September 2025 in seinem Domizil in Sundance1)
(Utah1))
im Alter von 89 Jahrn ein US-amerikanischer Künstler, der schon zu
Lebzeiten als Legende galt – er machte sich als Schauspieler, Regisseur und
Produzent in der Filmszene einen Namen. "Redford zählte zu den weltweit bekanntesten US-Schauspielern
und spielte in zahlreichen Hollywood-Welterfolgen mit. Sein großer Durchbruch gelang ihm 1969 an der Seite von
Paul Newman in dem Gangsterfilm
"Butch Cassidy und Sundance Kid"1). Weitere Erfolge waren unter anderen Filme wie
"Der Clou",
"Die drei Tage des Condor"1), "Die
Unbestechlichen"1) oder "Jenseits von Afrika". vermerkt
tagesschau.de in einem Nachruf.
In nachhaltiger Erinerung wird er auch mit seiner Rolle des Tom Booker in dem von ihm inszenierten
Spielfilm "Der Pferdeflüsterer"1) (1998,
"The Horse Whisperer") bleiben, basierend auf dem gleichnamigen
Roman1) von Nicholas Evans1). Als Regisseur wurde er am 31. März 1981
mit einem "Oscar"1)
("Beste Regie"1))
für die
Literaturadaption "Eine ganz normale Familie"1)
(1980, "Ordinary People") ausgezeichnet, die Pruktion erhielt drei
weitere "Academy Awards" sowie etliche andere Preise. 2002 würdigte man Redford mit
einem "Ehrenoscar"
für sein Lebenswerk. Der engagierte Umweltaktivist und Naturschützer, der sich bis ins
hohe Alter sein jugendliches Aussehen bewahrte – die stahlblauen Augen und der (einst) blonde
Haarschopf wurden zu seinem Markenzeichen – gründete zudem 1980 das
"Sundance Institute", das seit Jahrzehnten im Januar das bedeutende
"Sundance Film Festival"1)
für unabhängige amerikanische und internationale Produktionen veranstaltet. → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei www.zdfheute.de, www.ndr.de, www.tagesspiegel.de, www.deutschlandfunkkultur.de, www.zeit.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 10.09.2025 | Erneut ist ein beliebter Schauspieler von uns gegangen – am 5. September 2025
starb Horst Krause im Alter
von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow1)
(Landkreis Potsdam-Mittelmark1))
direkt am südwestlichen Stadtrand von Berlin. Der schwergewichtige Mime,
der sich nach einer Ausbildung zum Dreher für die Schauspielerei entschied
und sich an der
"Staatlichen
Schauspielschule"1) ("Hochschule
für Schauspielkunst Ernst Busch") entsprechend ausbilden ließ,
begann seine Karriere am "Landestheater
Parchim"1), wechselte dann 1969 an das "Städtische
Theater Karl-Marx-Stadt"
(heute "Theater Chemnitz"1)),
ab 1984 gehörte er für zehn Jahre zum Ensemble des "Staatsschauspiels Dresden"1).
Seit Mitte der 1980er Jahre wurde Krause zunehmend vom "Deutschen
Fernsehfunk"1) (DFF) mit
Hauptrollen besetzt und war vor allem in der beliebten Krimi-Reihe
"Polizeiruf 110"1)
auf dem Bildschirm präsent. Auch nach der so genannten "Wende"1)
blieb er dem "Polizeiruf 110" treu und mimte ab 1998 einfach
hinreißend den dicken Dorfwachtmeister Horst Krause1) mit der immer etwas zu kleinen Uniform, seinem
altmodischen Motorrad und Hund Mücke. Es sollte eine Art
Rolle seines Lebens werden, 17 Jahre lang unterstützte er bis 2015 auf unnachahmliche Weise
die jeweiligen Ermittlerinnen – diese
wechselten, Krause blieb. Erste bundesweite Aufmerksamkeit erlangte Horst Krause mit der von Detlev Buck1) gedrehten, satirischen Kino-Komödie "Wir können auch anders …"1) (1993) und der Rolle des Moritz Kipp alias "Most", dem Bruder von Rudi Kipp alias "Kipp" (Joachim Król1)), und wurde am 3. Juni 1993, ebenso wie sein Kollege Król, mit dem "Deutschen Filmpreis"1) in der Kategorie "Beste männliche Hauptrolle"1) ausgezeichnet. Neben etlichen weiteren Leinwandauftritten ist vor allem seine Titelrolle des in den Ruhestand geschickte Bergarbeiters Schultze in der Tragikomödie "Schultze gets the blues"1) (2003) zu nennen. Einmal mehr bewies Horst Krause hier sein humoristisches Talent und erhielt für seine darstellerische Leistung auch im Ausland zahlreiche Auszeichnungen, wie unter anderem den Preis als "Bester Darsteller" beim "Stockholm International Film Festival"1). Zudem erhielt er eine neuerliche Nominierung für den "Deutschen Filmpreis 2004"1) in der Kategorie "Beste männliche Hauptrolle", unterlag jedoch Birol Ünel1) in dem von Fatih Akin1) inszenierten Streifen "Gegen die Wand"1). Neben seiner Dauerrolle im "Polizeiruf 110" entstanden ab 2007 zwei ganz auf ihn zugeschnittene Reihen, in denen er anfangs als aktiver, dann als pensionierter Dorfpolizist Krause an der Seite seiner Schwestern Elsa (Carmen Maja Antoni) und Meta (Angelika Böttiger1)) in neun Geschichten bis 2022 glänzte. Zwischendurch brillierte er vier Mal (2015–2020) in der Reihe um den verwitweten Rentner Paul Krüger1). Mit Horst Krause, der 2012 mit dem "Verdienstorden des Landes Brandenburg"1) ausgezeichnet wurde, verlor die deutsche Film- und Fernsehlandschaft einen seiner markantesten und bekanntesten Künstler, der sich mit seiner unverwechselbaren Art in die Herzen des Publikums spielte. Aus Anlass seines Todes erinnerte der MDR am 08.09.2025 um 22:10 Uhr mit der rund 45-minütigen Dokumentation "Abschied von Horst Krause" an den populären Mimen, der privat eher die Öffentlichkeit scheute und ein eingefleischter Junggeselle war. In dem Film von Jens Rübsam "erzählen Wegbegleiter, Freunde und Kollegen wie die Schauspielerinnen Carmen-Maja Antoni und Angelika Böttiger1), Freund und Schauspiel‑Kollege Uwe Kockisch sowie Matthias Platzeck1), der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg1), von ihren Begegnungen mit Horst Krause. (…) Bodenständig und liebenswert, ausgestattet mit Herz und Gemüt. 17 Jahre lang verkörperte Schauspieler Horst Krause den Dorfpolizisten Krause im rbb "Polizeiruf 110" – stets unterwegs mit Motorradgespann und Hund und mit einer großen Portion Bauernschläue." (Quelle: www.mdr.de) → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de, www.fr.de, tagesspiegel.de, spiegel.de, www.zeit.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 08.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 02.09.2025 | Wie die Witwe von Arthur Brauss am 31. August 2025 die
Medien bzw. die Öffentlichkeit wissen
ließ, starb der Schauspieler wenige Tage zuvor im Alter von 89 Jahren in
seiner Münchener Wohnung. Zuletzt sei er sehr
geschwächt gewesen und rund um die Uhr gepflegt worden. "Er ist ganz friedlich eingeschlafen.
Das ist mein einziger Trost: dass er sich nicht quälen musste.", sagte
Marie Pocolin-Brauss gegenüber der "Deutschen
Presse-Agentur"1) (dpa).
(Quelle: t-online.de) Arthur Brauss, der seit Jahrzehnten im Münchner Stadtteil Schwabing1) lebte und nach über 50-jähriger Partnerschaft seit 2024 mit der Schauspielerin Marie Poccolin verheiratet war, avancierte seit den 1960er Jahren mit zahlreichen deutschen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen zum vielbeschäftigten Darsteller der Szene. Insgesamt wirkt er im Laufe der Jahrzente in rund 200 Produktionen mit, stellte des Öfteren raue Burschen und "Bösewichte" dar, ließ sich jedoch nie so ganz auf dieses Image festlegen. Die Liste seiner Serien-Auftritte ist lang, zum Serien-Star selbst avancierte er ab Mitte der 1980er Jahre mit dem Dauerbrenner "Großstadtrevier"1), wo er seit Beginn unter der Regie des Krimi-Spezialisten Jürgen Roland1) bis 1991 den altgedienten, etwas grimmig dreinschauenden Polizeiobermeister Richard Block spielte und nicht nur damit in nachhaltiger Erinnerung bleiben wird → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de, sueddeutsche.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 07.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 19.07.2025 | Am 16. Juli 2025 starb im Alter von 87 Jahren
in Pompano Beach1)
(Florida) die US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin
Connie Francis, die
Anfang der 1960er-Jahre auch einige deutschsprachige Erfolgstitel hatte.
Obwohl ihre Erfolge in den Popcharts
in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre nachließen, blieb sie im Bereich
der "Adult
Contemporary Music"1) weiterhin
erfolgreich und war bis in die 2010er Jahre als Livekünstlerin aktiv. In
Deutschland ist Francis vor allem für die Songs "Schöner fremder
Mann" sowie "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" bekannt, die
deutsche Version ihres Nummer-1-Hits "Everybody’s
Somebody’s Fool"1). (Quelle: Wikipedia)
"Mit ihrer Musik begeisterte Francis Jugendliche und Erwachsene und
hatte mehr als ein Dutzend Top-20-Hits. Auch Songs wie "Don't Break the Heart That Loves
You" und "The Heart Has a Mind of Its Own" kletterten an die Spitze der Charts. Ihre Platten wurden zu
weltweiten Hits, als sie Versionen ihrer Originalsongs auf Italienisch und Spanisch neu aufnahm."
vermerkt tagesschau.de.
→ Siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesspiegel.de,
taz.de,
www.faz.net. Weiterhin zu beklagen ist der Tod des Schauspielers Jürgen Schornagel, der bereits am 8. Juli 2025 – vier Tage vor seinem 86. Geburtstag – in Wester-Ohrstedt1) bei Husum1) starb. Er zählte zu den renommierten Schauspielern Deutschlands und konnte auf eine rund fünf Jahrzehnte andauernde, erfolgreiche Karriere bei Theater und Film zurückblicken. Besonders durch das Fernsehen wurde der Mann mit den markanten Gesichtszügen durch zahlreiche Serien sowie Einzelproduktionen mit prägnanten Rollen populär und galt als die Idealbesetzung des "Bösewichts". Das er aber auch außerhalb dieses Klischees zu überzeugen wusste, bewies er in etlichen Komödien wie in den Geschichten um die "Vier Meerjungfrauen"2) (2001/2006/2007), in Doku-Dramen wie "Das Wunder von Lengede"1) (2003), "Die Sturmflut"1) (2006) und "Hindenburg"1) (2011) oder in Abenteuern wie "Die Schatzinsel"1) (2007), frei nach dem gleichnamigen Roman1) von Robert Louis Stevenson1), wo er den Kapitän/Captain Smollett mimte. Hervorzuheben ist sein Part des stets gut "behüteten" Kriminalhauptkommissars Roland Winter1) sowie Vorgesetzter des Kommissarinnen-Teams in der RTL-Serie "Doppelter Einsatz"1), eine Figur, die er zwischen 1994 und 2002 59 Episoden lang spielte und für die er am 5. Oktober 2002 mit dem "Deutschen Fernsehpreis"1) ("Beste Nebenrolle" in "Der Mörder in Dir"2)) ausgezeichnet wurde; diese 66. Folge (EA: 16.01.2002) war zugleich sein letzter Auftritt in dieser RTL1)-Produktion und Winter "starb" den Serientod. Im Kino erlebte man Schornagel unter anderem in den prämierten Regie-Arbeiten von Joseph Vilsmaier1), so in der Literaturadaption "Schlafes Bruder"1) (1995) und in dem Biopic "Comedian Harmonists"1) (1997). Mit einer letzten Leinwandrolle präsentierte sich Schornagel in dem Krimi "Banklady"1) (2013), der Story über die von Nadeshda Brennicke1) dargestellten Gisela Werler1), die als erste deutsche Bankräuberin in die Schlagzeilen geriet und von der Öffentlichkeit als "Banklady" bezeichnet wurde; hier trat er als deren Vater Hans in Erscheinung. Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) fernsehserien.de |
||||
| 04.07.2025 | Am 3. Juli 2025 – rund sechs Wochen nach ihrem
85. Geburtstag – starb nach langem Leiden die beliebte
Schauspielerin Anita Kupsch.
Laut Medienberichten litt Anita Kupsch in den letzten Jahren unter
gesundheitlichen Problemen und hatte sich seit Ende der 2010er/Anfang der 2020er Jahre nahezu
vollkommen von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bereits im Frühjahr 2025
vermeldete die Presse, Anita Kupsch sei schwer an Demenz erkrankt; zuletzt lebte sie in einer Berliner
Pflegeeinrichtung. "Mehr als 50 Jahre spielte Anita Kupsch in Theater, Film und Fernsehen. Viele Zuschauer/-innen verbinden mit ihr aber besonders eine Rolle: Die der Arzthelferin Gabi Köhler in der Praxis von Dr. Peter Brockmann (Günter Pfitzmann) in der Serie "Praxis Bülowbogen"1). (…) Obwohl das TV-Publikum sie vor allem mit "Praxis Bülowbogen" verbindet, war Kupsch eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie war in fast 100 Rollen zu sehen. (…) Mit mehreren Bühnenstücken feierte sie Erfolge, etwa mit "Golden Girls"2) oder "Männer und andere Irrtümer"2). Nach Angaben des Berliner "Schlosspark Theaters"1) von Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden spielte Kupsch allein dieses Stück 1.700 Mal." informierte tagesschau.de. → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei spiegel.de, brisant.de, www.zeit.de, tagesspiegel.de Fremde Links: 1) Wikipedia, 2) komoedie-berlin.de |
||||
| 06.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 05.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 18.05.2025 | Am Morgen des 17. Mai 2025 starb im hohen Alter von 89 Jahren
in Wien die vielfach ausgezeichnete, österreichische Kammerschauspielerin bzw. "Burgtheater"1)-Doyenne
Elisabeth Orth.
Die Tochter der legendären
Paula Wessely
(1907 – 2000),und des nicht minder prominenten Attila Hörbiger
(1896 – 1987) feierte vor allem auf der Bühne aber auch bei Film und Fernsehen
Erfolge. Um nicht mit dem Namen "Hörbiger" Karriere zu machen,
nahm Elisabeth später den Mädchennamen ihrer Großmutter mütterlicherseits
an – Ehefrau Anna, geborene Orth, des Wiener Fleischermeisters Carl Wessely.
Auch ihre beiden jüngeren Schwestern
Christiane Hörbiger
(1938 – 2022) und
Maresa Hörbiger1)
(* 1945) traten in die Fußstapfen ihrer Eltern und zähl(t)en zur
ersten Garde deutschsprachiger Schauspielerinnen. "Das Haus trauert um Elisabeth Orth, eine der prägendsten Stimmen unseres Ensembles," zitiert die Mitteilung des "Burgtheaters" zu ihrem Tod den aktuellen künstlerischen Leiter Stefan Bachmann1). "Sie war nicht nur eine großartige Künstlerin, sondern auch in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement eine Instanz." (Quelle: Nachruf bei nachtkritik.de) → Weitere Nachrufe unter anderem bei stern.de, wien.orf.at, Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 04.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 26.04.2025 | Wie erst jetzt bekannt wurde, starb
bereits am 29. März 2025 – rund eine Woche
vor seinem 91. Geburtstag – in Schweinfurt1) der Schauspieler, Theaterregisseur und ehemalige Theaterintendant
Elert Bode.
Von 1970 bis 1976 leitete er die "Württembergische
Landesbühne Esslingen"1), anschließend war er Intendant der
Stuttgarter "Komödie im
Marquardt"1), seit der Wiedereröffnung im Herbst 1984 zugleich
Intendant des "Alten Schauspielhauses"1); im August 2002 ging
er nach mehr als 25 Jahren in den Ruhestand und gab die Funktion an
seinen Nachfolger Carl Philip von Maldeghem1) ab.
Neben seiner intensiven Arbeit für das Theater wurde der mehrfach ausgezeichnete Künstler einem breiten Publikum durch
zahlreiche TV-Produktionen bekannt. Seit Mitte der 1960er Jahre übernahm
er vermehrt Aufgaben vor der TV-Kamera, wirkte im Verlaufe seiner filmischen Karriere
wiederholt in beliebten Krimireihen/-serien wie
"Tatort"1),
"Ein Fall
für zwei"1), "Derrick"1),
"Polizeiruf 110"1),
"Der
Bulle von Tölz"1) oder "Der Alte"1)
mit, war zudem mit prägnanten Figuren in etlichen Einzelproduktionen
auf dem Bildschirm präsent. "Wir trauern um Elert Bode, der mit seinem Theaterschaffen einer der prägenden Charaktere der deutschen Theaterlandschaft im 20. Jahrhundert gewesen ist." schrieben die "Schauspielbühnen Stuttgart" unter anderem in einem Nachruf → schauspielbuehnen.de. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 24.04.2025 | Zwei beliebte Künstlerinnen sind von uns gegangen: Am 23. April 2025 starb im gesegneten Alter von 97 Jahren in Wien die österreichische Schauspielerin und Sängerin Waltraut Haas. Vor allem durch ihre Auftritte in Heimat- und Musikfilmen wie "Der Hofrat Geiger"1) (1947), "Gruß und Kuß: aus der Wachau"1) (1950) oder mit ihrer Paraderolle der Wirtin Josepha Vogelhuber in der Operetten-Adaption "Im weißen Röß:l"1) (1960) erlangte sie einen enormemn Bekanntheitsgrad und verkörperte meist den den Typus des "feschen Wiener Mädel". Als die große Zeit der leichten Filmkomödien zu Ende ging, konzentrierte sich Waltraut Haas vermehrt auf die Arbeit am Theater sowie beim Fernsehen, bereits seit Mitte der 1950er Jahre war sie auf dem Bildschirm in verschiedenen Produktionen präsent. Die seit Ende Juli 1966 bis zu dessen Tod am 20. April 2011 mit ihrem Kollegen Erwin Strahl verheiratete, mehrfach ausgezeichnete Künstlerin stand noch im hohen Alter auf der Bühne bzw. blieb schauspielerisch aktiv, feierte im Rahmen von Gastspielen und Tourneen – oft an der Seite ihres Ehemannes – Erfolge, so noch in den 2000ern bei den von ihrem Sohn Marcus Strahl1) geleiteten "Wachaufestspielen" im österreichischen Weißenkirchen1). Darüber hinaus veröffentlichte sie mehrere Langspielplatten, unter anderem "Im Weißen Rössl" und "Wiener Lieder", Mitte August 2018 kamen sie ihre Erinnerungen unter dem Titel "Jetzt sag ich's", aufgezeichnet von Marina C. Watteck, auf den Markt → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei spiegel.de, www.br.de, wien.orf.at. Mit Johanna Matz starb am 21. April 2025 in Wien 92-jährig eine weitere österreichische Schauspielern, die auf der Leinwand seit den 1950er Jahren sowie am Theater ebenfalls nachhaltige Spuren hinterließ. Die an der Wiener "Hochschule für Musik und darstellende Kunst"1) (1940–1948) und am "Max Reinhardt Seminar"1) (1948–1950) ausgebildete Schauspielerin wirkte an dem berühmten "Burgtheater"1), das mit Unterbrechung von zwei Jahren (1952 – 1954) bis 1993 Jahre ihre künstlerische Heimat bleiben sollte. Auf der Leinwand machte sie in etlichen, mitunter auch internationalen Nachkriegs-Produktionen Furore, wurde meist als nettes, braves und süßes Mädchen besetzt. Mit Beginn der 1960er Jahre zog sich Johanna Matz zunehmend vom Filmgeschäft zurück und stand hauptsächlich auf der Bühne, wo sie sich erfolgreich als Charakterdarstellerin etablierte. Sie interpretierte große, anspruchsvolle Rollen der Weltliteratur und war auch bei den "Salzburger Festspielen"1) präsent, konnte zudem in Operetten überzeugen. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie 1967 als bis dahin jüngste Interpretin zur "Kammerschauspielerin" ernannt, anlässlich der 200-Jahr-Feier des "Burgtheaters" würdigte man sie im April 1976 mit dem "Großen Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich"1). Darüber hinaus übernahm sie immer wieder sporadisch Aufgaben in vornehmlich österreichischen Fernsehproduktionen. In ihren letzten Jahren lebte sie zurückgezogen in Wien sowie in Unterach am Attersee1), stand jedoch gelegentlich immer wieder mal auf der Bühne und hielt Lesungen mit österreichischer Literatur ab → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei wien.orf.at, nachtkritik.de. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 03.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 31.03.2025 | Am 29. März 2025 starb – zwei Tage vor seinem 91. Geburtag – der US-amerikanische Schauspieler Richard Chamberlain in Waimānalo1) (Hawaii1)) an den Folgen eines Schlaganfalls. Hatte er bereits als attraktiver Serienheld "Dr. Kildare" in der gleichnamigen Arztserie (1961–1966) besonders beim weiblichen Publikum für Furore gesorgt sowie in den nachfolgenden Jahren mit Titel-/Hauptrollen in verschiedenen Kinoproduktionen Erfolge gefeiert, erreichte er in den 1980ern eine neuerliche, ungeheure Popularität im Fernsehen. Nachdem er als John Blackthorne bzw. Samurai in dem abenteuerlichen Fünfteiler "Shogun"1) (1980) die Zuschaue/-innen zu fesseln wusste, machte er als charismatischer Pater de Bricassart in dem melodramatischen Mehrteiler "Die Dornenvögel"1) (1983) (1983) nach dem Roman "The Thorn Birds"1) der australischen Schriftstellerin Colleen McCullough1) einmal mehr von sich reden – und zwar weltweit. Trotz seiner etlichen anderen schauspielerischen Erfolge bleibt Chamberlains Name untrennbar mit dieser Produktion verbunden, in der er er sich als katholischer Priester gegen alle Konventionen in die schöne Farmerstochter Meggie (Rachel Ward1)) verliebte, dieser Liebe schließlich entsagte und damit ein Millionenpublikum zu Tränen rührte. Jahrzehnte galt Chamberlain als Hollywoods "Herzensbrecher", der nicht nur auf der Leinwand und im Fernsehen, sondern in späteren Jahren auch auf der Theaterbühne brillierte – unter anderem 1993 am Broadway1) sowie nachfolgend im Rahmen einer Tournee als Prof. Henry Higgins in dem Musical "My Fair Lady"1) → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de, www.zdf.de, spiegel.de, focus.de | ||||
| 23.03.2025 | Am 22. März 2025 starb im hohen Alter
von 100 Jahren in München der
Schauspieler Rolf Schimpf. Obwohl er seit Ende der 1950er Jahre in zahlreichen TV-Filmen
bzw. Serien auf dem Bildschirm präsent war, wird er doch vor allem mit
einer Figur in nachhaltiger Erinnerung bleiben – rund 20 Jahre war er zwischen 1986 und 2007
das Gesicht des "Alten" in dem Krimi-Dauerbrenner
"Der Alte"1)
und trug als KHK Leo Kress
bzw. Nachfolger
von Siegfried Lowitz
(KHK Erwin Köster) maßgeblich zum Erfolg dieser ZDF-Produktion bei.
"Schimpf schaffte sich weltweit eine Fangemeinde, von Italien, Frankreich bis nach
Abu Dhabi, Brasilien und Südafrika. Nach der eingestellten Reihe
"Derrick"1) war
"Der Alte" der größte Exporterfolg des ZDF mit Verkäufen in mehr als hundert Länder."
vermerkt www.br.de
in einem Nachruf; → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei www.zdf.de,
www.zeit.de,
tagesspiegel.de Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 11.03.2025 | Am 9. März 2025 starb im Alter von 82 Jahren
in seiner Geburtsstadt Hamburg der beliebte Schauspieler
Hans Peter Korff. Der Sohn eines Buchdruckers – ursprünglich sollte er nach der Lehre
den väterlichen
Betrieb weiterführen – entschied sich schon früh für die
"Bretter, die die Welt bedeuten,
studierte ab 1962 zwei Jahre lang an der "Hochschule für Musik und Darstellende Kunst"1) in Hamburg
und avancierte mit den Jahren zu einem erfolgreichen Charakterdarsteller
sowohl auf der Bühne als auch bei Film und Fernsehen. Besonders die
Arbeit vor der TV-Kamera ließ populär werden, in nachhaltiger Erinnerung
wird er mit der Figur des skurrilen und trotteligen Briefträgers Heini Lüders
("Onkel Heini") in der Kinderserie
"Neues aus Uhlenbusch"1)
(1977–1982), in der norddeutsche Dorfgeschichten erzählt wurden, bleiben, aber auch mit seiner Rolle des Familienvaters Siegfried "Sigi" Drombusch,
Ehemanns von Vera (Witta Pohl), in dem Quotenrenner "Diese Drombuschs"1)
(1983–1987). Für seine Leistung in dieser TV-Serie wurde Hans Peter Korff
zusammen mit Witta Pohl als "Beliebtestes Serienpaar" mit
der "Goldenen Kamera"1)
ausgezeichnet; 1985 stieg er nach 13 Folgen aus der Serie aus,
wohl um nicht auf ein Rollenklischee festgelegt zu
werden. Seine Filmografie kann sich sehen lassen und umfasste im Laufe der
Jahrzehte über 160 Film- und Fernsehproduktionen. Darüber hinaus war er
ein gefragter Hörspiel-Sprecher und Rezitator, gemeinsam mit seiner
vierten Ehefrau Christiane Leuchtmann1), aber auch alleine,
hielt Korff regelmäßig Lesungen ab bzw. erfreute das Publikum mit literarischen
Abenden → siehe auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de,
www.ndr.de,
spiegel.de. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 02.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 28.02.2025 |
Am 26. Februar 2025, rund vier Wochen nach seinem 95. Geburtstag, wurden
der US-amerikanische Schauspieler bzw.
zweifache "Oscar"1)-Preisträger
Gene Hackman, seine Ehefrau Betsy Arakawa (63) sowie einer ihrer drei Hunde tot in ihrem Domizil in einer Gated Community1) in
Santa Fe1)
(New Mexico1))
aufgefunden. Aufgrund der
mysteriösen Todesumstände leitete die Polizei eine umfassende Untersuchung ein.
"Nach Angaben der Ermittler schien Hackman im Flur des Hauses gestürzt zu sein. Er trug
demnach ein T-Shirt und eine Jogginghose sowie Slipper. In der Nähe hätten sich eine Sonnenbrille und ein
Gehstock befunden. Seine Frau habe in einem Badezimmer neben einem Heizgerät gelegen. In der Nähe der Frau
seien eine geöffnete Dose mit einem verschreibungspflichtigen Medikament und auf einer Ablage verstreute Tabletten
gefunden worden. Laut Polizei wurde nahe der Leiche von Arakawa ein toter Schäferhund in einem Badezimmerschrank
entdeckt. Zwei gesunde Hunde seien auf dem Grundstück des Ehepaars gefunden worden – einer im Haus und einer draußen."
notierte tagesschau.de;
weitere Nachrufe unter anderem bei zdf.de, www.br.de,
www.taz.de Bei Wikipedia wird ausgeführt: "Aufgrund der verdächtigen Todesumstände leitete die Polizei eine umfassende Untersuchung ein. Diese ergab, dass Hackmann rund eine Woche nach seiner Frau, die einer Virusinfektion erlegen war, "wahrscheinlich (…) am 18. Februar 2025" an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben war. Auch wurde bei der Autopsie des 95-Jährigen eine fortgeschrittene Alzheimererkrankung festgestellt. Der zudem verendete Hund starb vermutlich an Dehydrierung und Hunger, die beiden anderen Tiere konnten sich dagegen durch eine Hundeklappe ins Freie begeben und dort selbst versorgen; sie kamen in die Obhut von Tierpflegern." (Stand: 18.03.2025) Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 27.02.2025 | Wie erst jetzt bekannt wurde, starb bereits am 20. Februar 2025 in
seinem Haus in Köln-Marienburg1)
der Schauspieler und
Kabarestist Ernst H. Hilbich
an den Folgen einer Lungenentzündung – nur
gut drei Wochen vor seinem 94. Geburtstag am 16. März. Der
vielseitige Künstler wirkte während seiner langen Karriere in zahlreichen Filmkomödien und
TV-Shows mit, war ebenso sie seine langjährige Lebensgefährtin bzw.
Ehefrau Lotti Krekel
(† 2023) aus dem Kölner Karneval nicht wegzudenken. Unvergessen
bleibt er mit dem Stimmungslied "Heut ist Karneval in Kniritz an der
Knatter!", mit dem er bereits Mitte der 1960er Jahre in der legendären
Sendung "Zum
Blauen Bock" das Publikum begeisterte und diesen Song als
"Prinz von Kniritz an der Knatter" fortan in vielen weiteren
Unterhaltungsshows zum Besten gab, mit einem jeweils
von Heinz Schenk neu umgeschriebenen Text. Als beliebter Sprecher lieh er nicht nur etlichen Figuren der
"Augsburger Puppenkiste"1) seine
markante Stimme.
Zu seinen letzten Auftritten vor der Kamera zählte die WDR-Familienserie
"Die Anrheiner"1), den Geschichten aus
dem kleinen "kölschen Veedel", wo Hilbich von 1998 bis 2010
als arbeitsloser Elektriker und gerissenes "Schlitzohr" Jupp Adamski
die Zuschauer/-innen erfreute → siehe auch den Nachruf bei www1.wdr.de
und tagesschau.de. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 01.2025 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 30.01.2025 | Am 28. Januar 2025 starb 89-jährig der beliebte
Schauspieler Horst Janson.
Erste Aufmerksamkeit erregte der stets jungenhaft wirkende Sohn eines
Justizbeamten im ersten Teil in dem von Alfred Weidenmann1)
nach dem gleichnamigen
Roman1) von Thomas Mann1) in Szene
gesetzten Zweiteiler "Buddenbrooks"1)
mit der Rolle des sensiblen Kapitänssohns/Studenten Morten Schwarzkopf1), den
Tony
Buddenbrook1) (Liselotte Pulver) während der Ferien lieben
lernt. Es folgten prägnante Parts sowohl in deutschen als auch
internationalen Kinoproduktionen an der Seite von Hollywood-Stars wie Lee Marvin,
Roger Moore
oder Richard Burton.
Seine größten Erfolge verdankte Horst Janson jedoch dem Fernsehen, bereits
seit Mitte der 1960er Jahre stand er vor der TV-Kamera. Unvergessen
bleibt er vor allem mit zwei Serien – als Trapezartist Sascha in "Salto mortale" (1969–1972) und
als "Titelheld" bzw. der liebenswerte und "ewige Student" Sebastian Guthmann,
der in "Der Bastian" (1973) die Frauenherzen höher schlagen ließ und nicht nur der Ärztin Dr. Katharina Freude
(Karin Anselm) den Kopf verdrehte. Ein weiteres Serien-Highlight – wenn auch ganz anderer Art – wurde seine
Dauerrolle in der "Sesamstraße"1), wo er
zwischen 1980 und 1983 – unter anderem
gemeinsam mit Liselotte Pulver – als
"Horst" zu sehen war. Bis ins hohe Alter blieb er aktiv, sein filmisches Schaffen kann sich sehen
lassen. Im Verlaufe seiner langen, erfolgreichen Karriere wirkte er in rund
170 Film- und Fernsehproduktionen mit, wusste zudem auf der Theaterbühne,
vornehmlich in Boulevardkomödien, das
Publikum zu begeistern. "Über viele Jahrzehnte war Horst Janson aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken", erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth1) anlässlich seines Ablebens. Die Nachricht von seinem Tod erfülle sie mit Traurigkeit: "Seine Schauspielkunst und seine herzliche Ausstrahlung werden uns fehlen." (Quelle: www.ndr.de) → Nachrufe unter anderem bei www.zeit.de, tagesschau.de, www.br.de |
||||
| 12.2024 | Updates / Ergänzungen
|
||||
| 29.12.2024 | Erst nach Weihnachten wurde bekannt, dass die vielfach
ausgezeichnete Bühnen-, Fiilm- und Fernsehschauspielerin Hannelore Hoger
bereits am 21. Dezember 2024
nach längerer,
schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimatstadt Hamburg
gestorben sei.
Um ihr genaues Alter betrieb die Künstlerin stets ein Verwirrspiel,
da sie die Frage nach ihrem Alter zeitlebens als "uncharmant"
betrachtete; so schwankten die Angaben zwischen 1940 und 1943. Die am 4. Januar 2025 unter
anderem im "Hamburger Abendblatt"1) veröffentlichte
Traueranzeige nennt nun dass Geburtsjahr 1939 → hamburgertrauer.de. Ausgebildet an der "Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Künste"1), begann die Tochter des Schauspielers und Bühneninspizienten Leo Hoger1) (1892 – 1972) ihre Karriere am Theater und machte sich rasch einen Namen als herausragende Charakterdarstellerin, brillierte unter anderem in etlichen Inszenierungen von Peter Zadek1). Hatte sie schon in verschiedenen Kino-Produktionen, unter anderem unter der Regie von Alexander Kluge1), auf sich aufmerksam gemacht, erlangte sie nicht zuletzt durch das Fernsehen ungeheure Popularität. Vor allem mit ihrer Dauerolle der Kommissarin "Bella Block" in den gleichnamigen Fernseh-Krimis1) des ZDF machte sie Furore. Hier trat Hoger seit der ersten Folge "Die Kommissarin"1) (EA: 26.03.1994) als emanzipatorische Frau in Aktion, die weiß, was sie will und löste instinktsicher, manchmal mit ungewöhnlichen Methoden, und sprödem Charme 38 Folgen lang in unregelmäßigen Abständen bis 2018 so manchen kniffligen Fall. Dass sie nicht nur als "Bella Block" zu überzeugen wusste, bewies sie im Laufe der Jahrzehnte in zahlreichen weiteren TV-Filmen, zu denen auch etliche Komödien zählten. Nicht nur die Medien würdigten nach ihrem Ableben die schauspielerischen Leistungen einer Künstlerin, die vor allem die Fernsehlandschaft maßgeblich prägte. So äußerte Carsten Brosda1), Hamburger Senator für "Kultur und Medien"1) sowie Präsident des "Deutschen Bühnenvereins"1), gegenüber der "Bild-Zeitung"1): "Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich ob am Theater, im Film oder im Fernsehen – sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Ihre Kunst war das psychologisch feinfühlige Spiel, ihre Gabe das Gespür für ein großes Publikum, und ihre Leidenschaft die unbedingte Freiheit. (…) Hamburg und die Schauspielwelt trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit, deren Werke noch lange wirken werden." (Quelle: www.welt.de) In ihrer 2017 veröfentlichten Biografie "Ohne Liebe trauern die Sterne" formulierte Hoger auch ihre Gedanken über den Tod: "Über uns schwebt das Damokles-Schwert. Je weiter das Leben voranschreitet, umso enger wird es. Aber wir wissen, dass wir dem nicht entgehen können, auch wenn wir es vielleicht möchten. Ich möchte, dass es dann schnell geht und dass man ohne Siechtum zum anderen Ufer kommt." Der NDR sendete am 28. Dezember 2024 die Doku & Reportage "In Erinnerung an Hannelore Hoger" (00:30 bis 01:00 Uhr) mit Ausschnitten aus verschiedenen Talk-Formaten und ehrte damit die Künstlerin als "eine der authentischsten und vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation.", die nicht nur als "Bella Block" nachhaltige Spuren hinterließ. Das ZDF änderte kurzfristig das Programm und zeigte am 28.12.2024 um 1:10 Uhr ihren letzten Film "Zurück ans Meer"1). Einen Tag später (29.12.2024) kam es ab 23:30 Uhr noch einmal zu einem Wiedersehen mit "Bella Block" in der Krimi-Folge "Das schwarze Zimmer"1) aus dem Jahre 2010. Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| 02.12.2024 | Mit Karin
Baal starb am 26. November 2024 in Berlin im Alter von 84 Jahren eine
Schauspielerin, die in der Filmgeschichte nachhaltige Spuren hinterließ.
Von der Presse als die "deutsche Antwort" auf Brigitte Bardot
gefeiert, machte die damals erst 16-jährige Tochter einer Schneiderin und
Fabrikarbeiterin in dem im Berlin der Nachkriegszeit angesiedelten Drama
"Die
Halbstarken"1) (1956) an der Seite von
Horst Buchholz Furore und ließ sie zur Legende werden.
In den nachfolgenden Jahren war sie in etlichen Kinofilmen zu sehen, fand vor allem ab den 1970ern ein zweites Standbein beim Fernsehen.
Ihre Kinder Thomas Baal (aus der ersten Ehe mit Karlheinz "Kalle" Gaffkus1))
und Therese Lohner1)
(aus der zweiten Ehe mit Helmut Lohner)
äußerten gegenüber der Presse:
"Sie hat eine Generation geprägt und wird unvergessen bleiben. Sie reißt ein riesiges Loch – nicht
nur in unsere Familie, sondern in Berlin und ganz Deutschland." → siehe
auch die Nachrufe unter anderem bei tagesschau.de,
stern.de,
www.faz.net Fremde Links: 1) Wikipedia |
||||
| Archiv | Link öffnet ein neues Fenster:
|
||||